 Kaum ein Faktor beeinflusst die persönliche Identitätsentwicklung und Sozialisation so früh und grundlegend wie die geschlechtliche Zuordnung. Gesellschaftlich festgeschriebene Rollenbilder und damit verbundene Erwartungen stellen schon sehr früh die Weichen für den persönlichen Lebensweg. Anhand der uns umgebenden Vorbilder beginnen wir von klein auf, unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Vorgelebte Rollen und ihre Merkmale werden als Normalität wahrgenommen, imitiert und gerade in der frühen Kindheit unreflektiert verinnerlicht. Daraus entwickeln sich Persönlichkeitsaspekte, die den Umgang mit anderen Menschen im weiteren Leben entscheidend mitbestimmen.
Kaum ein Faktor beeinflusst die persönliche Identitätsentwicklung und Sozialisation so früh und grundlegend wie die geschlechtliche Zuordnung. Gesellschaftlich festgeschriebene Rollenbilder und damit verbundene Erwartungen stellen schon sehr früh die Weichen für den persönlichen Lebensweg. Anhand der uns umgebenden Vorbilder beginnen wir von klein auf, unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Vorgelebte Rollen und ihre Merkmale werden als Normalität wahrgenommen, imitiert und gerade in der frühen Kindheit unreflektiert verinnerlicht. Daraus entwickeln sich Persönlichkeitsaspekte, die den Umgang mit anderen Menschen im weiteren Leben entscheidend mitbestimmen.
Der Einfluss von Rollenbildern zeigt sich ebenso im Kontext von Suchterkrankungen, denn sowohl im Konsumverhalten als auch in den Motiven für den Konsum lassen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede erkennen. „Beide Geschlechter leiden geschlechtstypisch und aus bipolar entgegengesetzten Gründen, denen die Einseitigkeit der Rollenverteilung zugrunde liegt.“ (Macha, Witzke 2008, S. 274) Als primäre Identifikationsfiguren gehören die Eltern zu den stärksten Einflussfaktoren, sie prägen die Auffassung der Geschlechterrollen entscheidend mit. Im Kontext von Männlichkeit kommt dem Vater als Rollenvorbild eine besondere Bedeutung zu. Stark sein, keine Schwäche zeigen, unbedingte Leistungsbereitschaft – dies sind Beispiele für Attribute, mit denen Klienten von Suchthilfeeinrichtungen ihre eigene Männerrolle häufig assoziieren. Es sind Attribute, die oftmals vom Vater vorgelebt und vom Sohn übernommen wurden. Auch das Trinken von Alkohol als männliche Verhaltensweise wird häufig vom direkten Rollenmodell abgeschaut und übernommen. Etwa ein Drittel der alkoholabhängigen Männer hatte selbst einen alkoholabhängigen Vater, was für eine generationsübergreifende Abhängigkeitsentwicklung spricht (vgl. Vosshagen 1997).
„Reine Männersache?! – Suchthilfe in NRW“
Um Fachkräfte für geschlechtsspezifische Perspektiven in der Arbeit mit suchtkranken Männern zu sensibilisieren und zu qualifizieren, startete die Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe im Juni 2017 das Projekt „Reine Männersache?! – Suchthilfe in NRW“. Im Verlauf des Projektes, das im August 2019 endete, wurden insbesondere elf Lehrfilme entwickelt, die relevante Themen aus der praktischen Arbeit mit suchtkranken Männern aufgreifen. Diese und weitere Ergebnisse des Projekts werden im Folgenden vorgestellt.
Filmreihe „Männlichkeiten und Sucht“
Die Filmreihe „Männlichkeiten und Sucht“ gibt Einblicke in die Gedankenwelt suchtkranker Männer. Es geht um vorherrschende Rollenbilder, damit verbundene Erwartungshaltungen und auch darum, wie mit dem daraus entstehenden Druck umgegangen werden kann. In den gesellschaftlich verankerten sozialen Geschlechternormen gibt es oft sehr wenig Spielraum: Entspricht eine Verhaltensweise nicht dem vorherrschenden Männerideal, so wird sie schnell als weiblich deklariert. Dies kann bei Männern zu einem inneren Druck führen, vor allem, wenn sie das weibliche Geschlecht noch immer mit dem „schwachen Geschlecht“ assoziieren. Somit wird das nicht-männliche Verhalten nicht nur automatisch weiblich, sondern auch als schwach wahrgenommen. Und Schwäche gilt eben als genaues Gegenteil des starken und unbezwingbaren Idealmannes.
Lust und Frust der Männerrolle
Die elf Kurzfilme der Reihe betrachten den Zusammenhang von männlichem Geschlecht und Suchtverhalten sowohl aus fachlicher als auch persönlicher Perspektive und greifen Themen auf, die in Therapie und Beratung oft von besonderer Bedeutung sind. Experten aus der Sucht- und/oder Männerarbeit sowie Betroffene kommen zu Wort und geben Einblick in ihre Erfahrungen. Aspekte wie Sexualität, Gewalterfahrungen oder das Verhältnis von Arbeit und Freizeit sind zwar nicht ausschließlich Männerthemen, es handelt sich jedoch um Themenbereiche, in denen gesellschaftlich oft noch eine ziemlich feste und unflexible Vorstellung des idealen Mannes herrscht: Männer sind Verführer, nicht Verführte, manchmal Täter, nie Opfer, und immer ganz oben in Sachen Kompetenz im Arbeitsbereich. Auch wenn es mittlerweile einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess gibt, der mit einer Pluralisierung dieses Rollenbildes einhergeht, ist es noch immer weit verbreitet und bei Männern oft tief im Selbstverständnis verankert.
Die Betrachtung von Suchtverhalten aus geschlechtsspezifischer Sicht bietet eine besondere Verständnisebene, die für den Therapieprozess förderlich sein kann. Oft genug dient das Suchtmittel als Ventil zum Abbau von Druck, der aus dem Gefühl heraus entsteht, dem gesellschaftlichen Rollenbild nicht gerecht werden zu können. Auch das Verständnis der familiären Rollenverteilung oder von Partnerschaft kann eng mit der verinnerlichten Geschlechterrolle zusammenhängen. Das Zusammenspiel von Geschlecht und dem Konsum von Rauschmitteln ist vielschichtig und oftmals tief im Unbewussten jedes Einzelnen verankert.
Film: Modul 1 – Lust und Frust der Männerrolle
Sucht und Männlichkeit
Seit rund 20 Jahren befasst sich die LWL-Koordinationsstelle Sucht schon mit dem Thema „Männlichkeiten und Sucht“. Die Relevanz des geschlechtsspezifischen Aspektes wird auch bei einem Blick auf folgende Zahlen deutlich: Weltweit lassen sich gravierende Unterschiede im Konsumverhalten von Männern und Frauen feststellen. So wurden in Deutschland im Jahr 2015 100.000 Fälle von Alkoholabhängigkeit bei Männern diagnostiziert, bei Frauen dagegen „nur“ 36.000 (Deutsches Krebsforschungszentrum 2017). In Suchteinrichtungen stellen Männer zwei Drittel der Klienten. Männer konsumieren in den meisten Kategorien (mit Ausnahme von Medikamenten) härter, häufiger und riskanter als Frauen und tun dies auch häufiger in der Öffentlichkeit. Alkohol und Tabak sind bekannte Beispiele für männlich konnotierte Suchtmittel: Jeder kennt das Bild des großgewachsenen, harten und natürlich rauchenden Cowboys oder das des Whisky trinkenden und Zigarre rauchenden erfolgreichen Geschäftsmannes. Dies sind nur zwei von vielen gängigen Klischees. Übertrieben männliche Rollenbilder gibt es in den Medien zuhauf. Das Ungleichgewicht im Konsumverhalten zwischen den Geschlechtern erstreckt sich über Tabak und Alkohol hinaus auch auf die meisten anderen Substanzen. Die Demonstration, viel vertragen zu können, dient der Darstellung von Macht und Stärke – und so eben auch von Männlichkeit. Das verinnerlichte Konstrukt der eigenen Geschlechterrolle ist dabei ebenso unflexibel wie empfindlich: Jede Abweichung vom vermeintlich männlichen Verhaltenskodex wird direkt mit Unmännlichkeit assoziiert und bietet so Angriffsfläche für Hohn und Spott der Geschlechtsgenossen.
Obwohl Gender-Mainstreaming und die Berücksichtigung des sozialen Geschlechts mittlerweile weitgehend als förderlicher Aspekt in der Ansprache von Suchtkranken betrachtet werden, ist männerspezifische Suchtarbeit in vielen Einrichtungen nicht strukturell verankert (vgl. Stöver et al. 2017, S. 9). Für den Klienten können deshalb in Gesprächen Hemmschwellen entstehen, wenn es beispielsweise um ein sensibles Thema wie Sexualität geht. Um nicht in unangenehme Situationen zu kommen, werden wichtige Themen im Zweifel also lieber nicht angesprochen und können somit auch nicht erfolgreich bearbeitet werden.
Um geschlechtersensibel arbeiten zu können, ist es für Fachkräfte notwendig, sich die eigene Geschlechtsauffassung bewusst zu machen. Verinnerlichte Rollenzuschreibungen müssen reflektiert und hinterfragt werden, vor allem auch unter Berücksichtigung der sich ständig verändernden gesellschaftlichen Realität: Rollenbilder wandeln sich zunehmend, neue und oftmals widersprüchliche Erwartungen und die damit einhergehenden Auswirkungen auf Sozialisationsprozesse und Wahrnehmungsmuster können zu mangelnder Orientierung und damit zu wachsender Unsicherheit führen. Ein klarer und konsequenter Standpunkt zur eigenen Geschlechterrolle ist für die Fachkraft daher notwendig, um dem Klienten eine zuverlässige Orientierungshilfe zu sein.
Nicht nur für weibliche Fachkräfte kann männersensible Arbeit eine Herausforderung darstellen. Konkurrenzdenken und Imponiergehabe beispielsweise sind zwischen Männern oft Störfaktoren für eine konstruktive Gesprächsführung. Eine ausgeprägte Leistungsorientierung, bei der Erfolge hochgelobt und Rückschläge totgeschwiegen werden, kann effektives Arbeiten deutlich erschweren. Auch hier taucht schließlich wieder die Befürchtung auf: Wer Hilfe braucht, gilt als schwach und unmännlich. Leichter und unverfänglicher ist es da, eigene Leistungen zu betonen und sich zu profilieren. Die Erkenntnis, dass die Abweichung von männlichen Rollenklischees nicht gleichbedeutend mit dem Verlust der eigenen Männlichkeit ist, muss häufig erst noch erarbeitet werden. Durch das Erkennen und Verstehen der mit dem Geschlecht verbundenen Gründe und Funktionen des Konsums kann der Klient dabei unterstützt werden, alternative und vor allem risikoärmere Verhaltensweisen zu entwickeln und das Ausleben seiner Männlichkeit vom Konsumverhalten zu trennen. Das Aufdecken von jungen- und männerspezifischen Mythen im Kontext des Suchtmittelkonsums ist ein ebenso notwendiger Schritt wie das Umdenken von Leistungs- und Exzessorientierung zur Genussorientierung (vgl. Heckmann 2007).
Film: Modul 2 – Sucht und Männlichkeit
Praxishandbuch „Männlichkeiten und Sucht“
In dem von der LWL-Koordinationsstelle Sucht herausgegebenen Praxishandbuch „Männlichkeiten und Sucht“ wurde das Thema für die ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthilfe praxisorientiert aufbereitet. Die aktuelle dritte Auflage von 2017 berücksichtigt Ergebnisse der 2014 durch das Institut für Suchtforschung (ISF) erfolgten Evaluation und diente als Ausgangsbasis der Arbeit des Projektes „Reine Männersache?! – Suchthilfe in NRW“. Das Handbuch ist in elf Themenmodule gegliedert, welche neben dem grundsätzlichen Zusammenhang von Geschlecht und Sucht auch Aspekte wie Vaterschaft, Partnerbeziehungen, Familie, Freundschaften und Emotionalität behandeln. Die einzelnen Module werden ausführlich beleuchtet, und ausgewählte Methoden zur praktischen Gruppenarbeit mit Klienten werden vorgestellt und detailliert beschrieben. Die Methoden sind in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen eingeteilt, welche dabei helfen sollen, sie entsprechend der Komplexität und Teilnahmebereitschaft der Arbeitsgruppe angemessen auszuwählen. Benötigte Arbeitsmaterialen für die Anwendung der Methoden werden auf der beiliegenden CD-ROM mitgeliefert.
Fortbildungsprogramm
Durch das im Rahmen des Projektes entwickelte Fortbildungsprogramm werden männliche Fachkräfte für die geschlechtsspezifische Arbeit mit suchtkranken Männern nicht nur sensibilisiert, sondern auch qualifiziert. Aufbauend auf den Modulen des Praxishandbuchs werden ihnen konkrete Methoden und Handlungsempfehlungen vermittelt, um durch geschlechtssensible Arbeit einen besseren Zugang zu ihren Klienten zu bekommen.
Die Fortbildungen beinhalten Informationen zu männlicher Sozialisation, zu Abwehrmechanismen sowie männlichem (Sucht-)Verhalten und Erleben. Die Teilnehmer führen praktische Übungen in der Rolle des Gruppenleiters einerseits und in der Rolle des Klienten andererseits durch. Ziel der Fortbildungen ist es, Fachkräfte zu befähigen, mit unterschiedlichen Gruppendynamiken umzugehen und männerspezifische Angebote in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.
Im September und November 2018 sowie im Februar 2019 wurden die jeweils dreitägigen Fortbildungen mit insgesamt 36 Teilnehmern durchgeführt. Die im Rahmen der Projektförderung begrenzten Teilnehmerplätze waren schnell ausgebucht, sodass die Koordinationsstelle Sucht im April 2019 bereits einen Zusatztermin anbot. Die durchweg positive Evaluation der Fortbildungsveranstaltungen sowie die hohe Nachfrage zeigen deutlich, dass dem Thema in der praktischen Arbeit eine hohe Relevanz zukommt. Auch 2020 findet die Fortbildung „Männlichkeiten und Sucht“ daher wieder statt (9. bis 11. September 2020 in Freckenhorst).
Arbeitskreis Mann & Sucht
Neben den Fortbildungen bietet auch der Arbeitskreis Mann & Sucht männlichen Fachkräften in der Suchthilfe ein Forum zum kollegialen Austausch. Er gibt ausgewählte Impulse zur männerspezifischen Suchtarbeit, eröffnet Perspektiven und dient darüber hinaus als Plattform für aktuell relevante Themen aus den Einrichtungen der Teilnehmer.
Weiteres Material
Mit der Projektwebsite www.maennersache-sucht.de wurde eine Plattform gestaltet, über die sich Interessierte einen ersten Einblick in das Thema und die einzelnen Module des Handbuchs verschaffen können. Auch die im Projekt erstellten Filme sind hierüber abrufbar. Um das Thema darüber hinaus weiterzuverbreiten, wurden außerdem Poster, Postkarten und Taschentuchboxen mit speziell für den Kontext erstellten Motiven produziert. Obwohl die männlichen Fachkräfte im Fokus des Projektes stehen, sollen diese Materialien auch weiblichen Fachkräften als Aufhänger für den kollegialen Erfahrungsaustausch und als Einstiegsmöglichkeit im Klientenkontakt dienen. Die Projektaktivitäten zielen auf eine Verbesserung der gender- bzw. männersensiblen Arbeitsweisen in der Suchthilfe ab, wovon letztendlich vor allem suchtgefährdete und abhängigkeitserkrankte Jungen und Männer profitieren sollen.
Ausblick
Die Erfahrung, dass das Verständnis der eigenen Männlichkeitskonstruktion und ihres Zusammenhangs mit der persönlichen Suchtbiografie wichtig und förderlich sein kann, unterstreichen auch die interviewten Männer der Filmreihe: „Ich kann einen gewissen Stolz empfinden, die Sucht überwunden zu haben. Und auch die Freiheit, machen zu können, was ich möchte, und nicht in der Sucht gefangen zu sein. Von daher fühle ich mich jetzt deutlich männlicher als zu abhängigen Zeiten.“ (F. Happel im Film „Modul 2: Sucht und Männlichkeiten“, ab 4:21).
Mit Ende der 27-monatigen Laufzeit am 30. August 2019 ist das Projekt „Reine Männersache!? – Suchthilfe in NRW“ zwar abgeschlossen, das Thema jedoch bleibt weiterhin relevant. Was heißt es heute, ein Mann zu sein? Wie erleben sich Männer mit männlichen Klienten in der Suchthilfe? Wie können Frauen von den bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen profitieren? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Veranstaltung zum Projektabschluss am 12. Juni 2019, mit der im Rahmen des Projektes ein letzter Impuls gesetzt werden konnte. Zum einen wurden die gesammelten Projektergebnisse der Fachöffentlichkeit vorgestellt, zum anderen sollte vor allem das Thema sowohl männlichen als auch weiblichen Fachkräften zugänglich gemacht und dessen Wichtigkeit betont werden. Von Mitgliedern des Fachbeirats durchgeführte Workshops luden dazu ein, sich mit einzelnen Aspekten vertiefend zu beschäftigen, und boten die Möglichkeit zum kollegialen Diskurs. Die erstellten Informationsmaterialien, die in das Fortbildungsprogramm des LWL aufgenommenen Fortbildungen, die Projektwebsite sowie nicht zuletzt die Filmreihe „Männlichkeiten und Sucht“, welche nicht nur im Internet, sondern auch auf DVD erhältlich ist, sollen nachhaltig die Sensibilisierung für die besonderen Chancen und Herausforderungen männerspezifischer Suchtarbeit unterstützen.
Das Projekt „Reine Männersache!? – Suchthilfe in NRW“ wurde gefördert vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Maßnahme des Aktionsplans gegen Sucht NRW.
Kontakt:
Sandy Doll, sandy.doll@lwl.org
Maik Pohlmann, maik.pohlmann@lwl.org
Markus Wirtz, markus.wirtz@lwl.org
Projektkoordination „Reine Männersache!? – Suchthilfe in Nordrhein-Westfalen“
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Dezernat 50
LWL-Koordinationsstelle Sucht
48133 Münster
Literatur:
- Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.), Alkoholatlas Deutschland 2017. URL: http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/sonstVeroeffentlichungen/Alkoholatlas-Deutschland-2017_Doppelseiten.pdf (Stand: 25.10.2018)
- Heckmann, Gier, Macht, Ohnmacht: Männliches Suchtverhalten. In: W. Hollstein, M. Matzner (Hrsg.), Soziale Arbeit mit Jungen und Männern. München 2007, S. 155 – 173
- Macha, M. Witzke, Familie und Gender. Rollenmuster und segmentierte gesellschaftliche Chancen. Frankfurt am Main 2008
- Stöver, A. Vosshagen, P. Bockholdt, F. Schulte-Derne, Männlichkeiten und Sucht – Handbuch für die Praxis, Hrsg.: Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Münster 2017
- Vosshagen, Geschlechtsspezifische Aspekte der Alkoholabhängigkeit bei Männern. Dissertation. Essen 1997
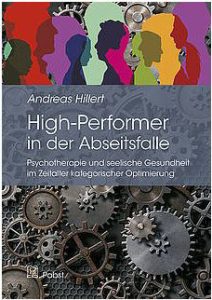 Leistungssteigerung, Beschleunigung, Optimierung, alles nach oben hin grenzenlos offen und nach unten hin bodenlos. Paradoxien und Abgründe dieser Dynamik sind so offenkundig, wie die Unfähigkeit, diesbezüglich Abstand und Alternativen zu finden. Jeder, der über schönere, schnellere und bessere Illusionen hinauszudenken versucht, stößt auf diese kategorische Problematik. Lippenbekenntnisse zur Entschleunigung und (neuen) Werteorientierung bleiben so lange wertlos, wie sie primär nur Regenerationspausen zugunsten weiterer Leistungssteigerung intendieren. Der Psychiater und Psychotherapeut Andreas Hillert analysiert die Situation anhand aktueller Forschungsbefunde und eigener ärztlicher Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund stellt er fünf individuelle Schicksale gescheiterter High-Performer vor und gleichzeitig fünf engagierte, qualifizierte, aber gründlich gescheiterte Therapieversuche (u. a. von Essstörungen, Angststörungen, Depressionen). Es bleibt den Lesern überlassen, nach strategischen, sozialen, politischen, religiös-spirituellen und vor allem auch nach psychotherapeutischen Auswegen für diese und ähnliche Konstellationen zu suchen.
Leistungssteigerung, Beschleunigung, Optimierung, alles nach oben hin grenzenlos offen und nach unten hin bodenlos. Paradoxien und Abgründe dieser Dynamik sind so offenkundig, wie die Unfähigkeit, diesbezüglich Abstand und Alternativen zu finden. Jeder, der über schönere, schnellere und bessere Illusionen hinauszudenken versucht, stößt auf diese kategorische Problematik. Lippenbekenntnisse zur Entschleunigung und (neuen) Werteorientierung bleiben so lange wertlos, wie sie primär nur Regenerationspausen zugunsten weiterer Leistungssteigerung intendieren. Der Psychiater und Psychotherapeut Andreas Hillert analysiert die Situation anhand aktueller Forschungsbefunde und eigener ärztlicher Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund stellt er fünf individuelle Schicksale gescheiterter High-Performer vor und gleichzeitig fünf engagierte, qualifizierte, aber gründlich gescheiterte Therapieversuche (u. a. von Essstörungen, Angststörungen, Depressionen). Es bleibt den Lesern überlassen, nach strategischen, sozialen, politischen, religiös-spirituellen und vor allem auch nach psychotherapeutischen Auswegen für diese und ähnliche Konstellationen zu suchen.




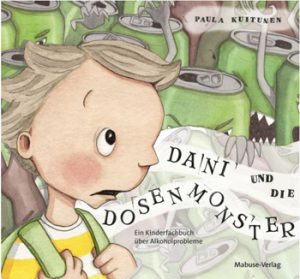



 Kaum ein Faktor beeinflusst die persönliche Identitätsentwicklung und Sozialisation so früh und grundlegend wie die geschlechtliche Zuordnung. Gesellschaftlich festgeschriebene Rollenbilder und damit verbundene Erwartungen stellen schon sehr früh die Weichen für den persönlichen Lebensweg. Anhand der uns umgebenden Vorbilder beginnen wir von klein auf, unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Vorgelebte Rollen und ihre Merkmale werden als Normalität wahrgenommen, imitiert und gerade in der frühen Kindheit unreflektiert verinnerlicht. Daraus entwickeln sich Persönlichkeitsaspekte, die den Umgang mit anderen Menschen im weiteren Leben entscheidend mitbestimmen.
Kaum ein Faktor beeinflusst die persönliche Identitätsentwicklung und Sozialisation so früh und grundlegend wie die geschlechtliche Zuordnung. Gesellschaftlich festgeschriebene Rollenbilder und damit verbundene Erwartungen stellen schon sehr früh die Weichen für den persönlichen Lebensweg. Anhand der uns umgebenden Vorbilder beginnen wir von klein auf, unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Vorgelebte Rollen und ihre Merkmale werden als Normalität wahrgenommen, imitiert und gerade in der frühen Kindheit unreflektiert verinnerlicht. Daraus entwickeln sich Persönlichkeitsaspekte, die den Umgang mit anderen Menschen im weiteren Leben entscheidend mitbestimmen.