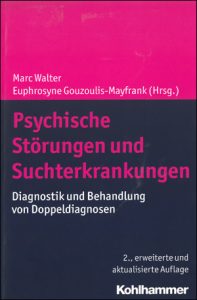Lange war umstritten, ob sexuelles Verhalten zu einem klinisch relevanten Problem werden kann. In der Neuauflage des International Classification of Diseases (ICD), dem offiziellen Diagnoseregister der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wird mittlerweile die Diagnose „Zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung“ geführt. An der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen erforscht die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Rudolf Stark (Psychotherapie und Systemneurowissenschaften) seit Jahren dieses Krankheitsbild. Diese beschreibt eine Störung, die oft als sexuelle Sucht bezeichnet wird, da die Betroffenen unfähig sind, ihr problematisches sexuelles Verhalten zu reduzieren oder einzustellen, obwohl es für sie mit massiven negativen Folgen verbunden ist.
Von der Störung sind besonders häufig Männer betroffen, die ihren Pornographiekonsum nicht kontrollieren können. Pornographiekonsum, der sich täglich über mehrere Stunden hinzieht, kann zu Problemen am Arbeitsplatz und auch im privaten Bereich führen. Aktuell untersucht das Team in einer groß angelegten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Studie die neuronalen Veränderungen bei der Verarbeitung sexueller Reize. Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) werden die hirnphysiologischen Reaktionen auf sexuelle Reize getestet. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob akuter Stress etwas an diesen hirnphysiologischen Reaktionen verändert. Erste vorläufige Analysen legen nahe, dass sich bei der „Zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung“ Ähnlichkeiten zu Suchterkrankungen finden lassen. Lassen sich diese Befunde bestätigen, so hat dies weitreichende Konsequenzen für die Diagnostik und die Therapie dieser Störung.
Neben dieser neurobiologischen Grundlagenstudie wurde in der verhaltenstherapeutischen Ambulanz der JLU ein auf verhaltenstherapeutischen Grundprinzipien beruhendes Therapieprogramm entwickelt, das als Gruppenangebot durchgeführt werden soll. Hierzu wird im Frühjahr 2020 eine neue Studie beginnen, die die Wirksamkeit des Behandlungsprogramms untersucht.
Um die verschiedenen Forschungsprojekte erfolgreich durchzuführen, sucht das Forscherteam kontinuierlich betroffene Männer zwischen 18 und 45 Jahren, die ihren Pornographiekonsum nicht kontrollieren können. Diese können bei Interesse – und bei Zutreffen der Einschlusskriterien, die in einem Telefonat abgeklärt werden – an der fMRT-Untersuchung teilnehmen. Bei Bedarf wird auch ein kostenloses Beratungsgespräch angeboten, um Klärung anzubieten, ob weitergehende psychotherapeutische Hilfe nötig ist.
Interessierte können sich per E-Mail unter pornstudies@psychol.uni-giessen.de melden.
Weitere Informationen unter: http://www.pornstudies-giessen.de
Pressestelle der Justus-Liebig-Universität Gießen, 01.10.2019