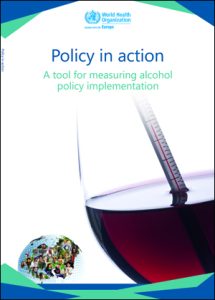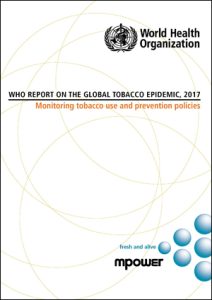Im September 2016 fand in Greifswald gemeinsam mit der DG-Sucht eine vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Klausurwoche zum Thema „Das Stigma von Suchterkrankungen verstehen und überwinden“ statt. Die Ergebnisse der Tagung, die federführend von Georg Schomerus, einem international angesehenen Stigmaforscher von der Universität Greifswald, in Kooperation mit Annemarie Heberlein (Medizinische Hochschule Hannover) und Hans-Jürgen Rumpf (Universität zu Lübeck) durchgeführt wurde, liegen seit Frühjahr 2017 in Form eines Memorandums vor. Das Memorandum wurde von einer interdisziplinären und internationalen Gruppe von Wissenschaftlern, Praktikern und Betroffenen konsentiert und unternimmt den Versuch, das Phänomen der Stigmatisierung von Menschen mit Suchtkrankheiten zu erklären und Wege aufzuzeigen, wie ein stigmafreier Umgang mit Suchtkrankheiten aussehen kann. Zu folgenden Bereichen werden Empfehlungen formuliert: Empowerment, qualitative Verbesserungen im Hilfesystem, konzeptionelle und rechtliche Weiterentwicklungen, Forschung sowie Koordination und Kommunikation der Anti-Stigma Aktivitäten.
Im September 2016 fand in Greifswald gemeinsam mit der DG-Sucht eine vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Klausurwoche zum Thema „Das Stigma von Suchterkrankungen verstehen und überwinden“ statt. Die Ergebnisse der Tagung, die federführend von Georg Schomerus, einem international angesehenen Stigmaforscher von der Universität Greifswald, in Kooperation mit Annemarie Heberlein (Medizinische Hochschule Hannover) und Hans-Jürgen Rumpf (Universität zu Lübeck) durchgeführt wurde, liegen seit Frühjahr 2017 in Form eines Memorandums vor. Das Memorandum wurde von einer interdisziplinären und internationalen Gruppe von Wissenschaftlern, Praktikern und Betroffenen konsentiert und unternimmt den Versuch, das Phänomen der Stigmatisierung von Menschen mit Suchtkrankheiten zu erklären und Wege aufzuzeigen, wie ein stigmafreier Umgang mit Suchtkrankheiten aussehen kann. Zu folgenden Bereichen werden Empfehlungen formuliert: Empowerment, qualitative Verbesserungen im Hilfesystem, konzeptionelle und rechtliche Weiterentwicklungen, Forschung sowie Koordination und Kommunikation der Anti-Stigma Aktivitäten.
Seit seinem Erscheinen wurde das Memorandum im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen vorgestellt und diskutiert, u. a. auf dem Deutschen Suchtkongress 2017, der Mitte September in Lübeck stattgefunden hat. Das Memorandum finden Sie hier.
Quelle: Website der DG-Sucht, September 2017