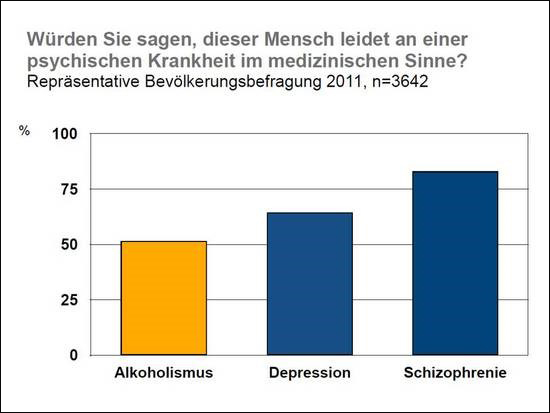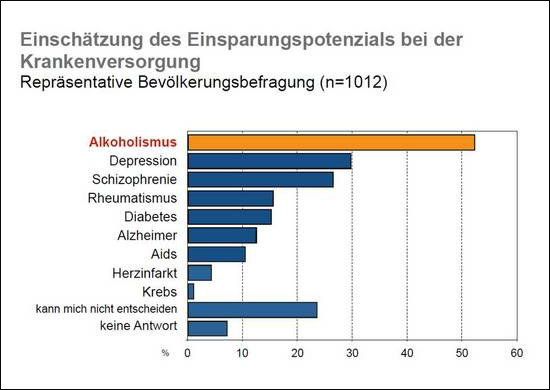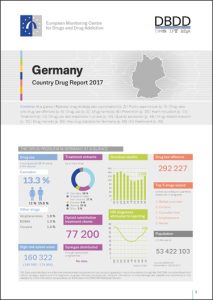Die steigende Zahl der Todesfälle durch Überdosierung, die anhaltende Verfügbarkeit neuer psychoaktiver Substanzen und die zunehmenden Gesundheitsgefahren durch hochpotente synthetische Opioide zählen zu den Themen des „Europäischen Drogenberichts 2017. Trends und Entwicklungen“, den die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) in am 6. Juni in Brüssel vorgelegt hat. In ihrem jährlichen Überblick befasst sich die Agentur zudem mit den Anzeichen für eine steigende Verfügbarkeit von Kokain, den Entwicklungen im Bereich der Cannabispolitik und dem Substanzkonsum unter Schülern. Da die Drogenproblematik in Europa zunehmend von internationalen Entwicklungen beeinflusst wird, wurde die Analyse in einen globalen Kontext eingebettet. Die im Bericht vorgelegten Daten beziehen sich auf das Jahr 2015 bzw. das jeweils letzte Jahr, für das Daten verfügbar sind.
Die steigende Zahl der Todesfälle durch Überdosierung, die anhaltende Verfügbarkeit neuer psychoaktiver Substanzen und die zunehmenden Gesundheitsgefahren durch hochpotente synthetische Opioide zählen zu den Themen des „Europäischen Drogenberichts 2017. Trends und Entwicklungen“, den die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) in am 6. Juni in Brüssel vorgelegt hat. In ihrem jährlichen Überblick befasst sich die Agentur zudem mit den Anzeichen für eine steigende Verfügbarkeit von Kokain, den Entwicklungen im Bereich der Cannabispolitik und dem Substanzkonsum unter Schülern. Da die Drogenproblematik in Europa zunehmend von internationalen Entwicklungen beeinflusst wird, wurde die Analyse in einen globalen Kontext eingebettet. Die im Bericht vorgelegten Daten beziehen sich auf das Jahr 2015 bzw. das jeweils letzte Jahr, für das Daten verfügbar sind.
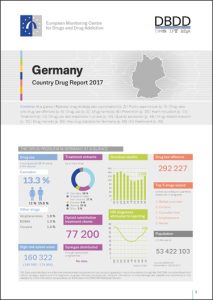 Der Europäische Drogenbericht wird erstmals durch 30 Länderdrogenberichte mit Übersichten über die nationale Drogenproblematik (EU-28, Türkei und Norwegen) ergänzt. Diese von der EMCDDA in Zusammenarbeit mit den nationalen Reitox-Knotenpunkten erstellten Berichte beinhalten zahlreiche Grafiken und behandeln folgende Themen: Drogenkonsum und Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Drogenpolitik und Gegenmaßnahmen sowie Drogenangebot. Jeder dieser Berichte enthält insbesondere eine Übersichtstabelle, in der die nationale Drogenproblematik in Zahlen zusammenfassend dargestellt wird und ein „EU-Dashboard“, das die Länderdaten in einen europäischen Kontext einbettet.
Der Europäische Drogenbericht wird erstmals durch 30 Länderdrogenberichte mit Übersichten über die nationale Drogenproblematik (EU-28, Türkei und Norwegen) ergänzt. Diese von der EMCDDA in Zusammenarbeit mit den nationalen Reitox-Knotenpunkten erstellten Berichte beinhalten zahlreiche Grafiken und behandeln folgende Themen: Drogenkonsum und Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Drogenpolitik und Gegenmaßnahmen sowie Drogenangebot. Jeder dieser Berichte enthält insbesondere eine Übersichtstabelle, in der die nationale Drogenproblematik in Zahlen zusammenfassend dargestellt wird und ein „EU-Dashboard“, das die Länderdaten in einen europäischen Kontext einbettet.
Zahl der Todesfälle durch Überdosierung steigt das dritte Jahr in Folge
Im Europäischen Drogenbericht 2017 (EDR) wird auf den besorgniserregenden Anstieg der Zahl der Todesfälle durch Überdosierung in Europa hingewiesen, der sich mittlerweile das dritte Jahr in Folge fortsetzt. In Europa (28 EU-Mitgliedstaaten, Türkei und Norwegen kam es im Jahr 2015 zu insgesamt 8.441 Todesfällen durch Überdosierung, die zumeist mit Heroin und anderen Opioiden in Verbindung stehen. Dies entspricht einem Anstieg um sechs Prozent gegenüber der im Jahr 2014 in diesen 30 Ländern ermittelten Zahl von schätzungsweise 7.950 Todesfällen. Die zunehmende Entwicklung betraf nahezu alle Altersgruppen. Ein Anstieg der Zahl der Todesfälle durch Überdosierung wurde im Jahr 2015 aus Deutschland, Litauen, den Niederlanden, Schweden, dem Vereinigten Königreich und der Türkei gemeldet. Zu den am stärksten gefährdeten Personengruppen zählen die 1,3 Millionen problematischen Opioidkonsumenten in Europa.
In den toxikologischen Berichten werden regelmäßig auch Opioide genannt, die in der Substitutionsbehandlung eingesetzt werden – in erster Linie Methadon und Buprenorphin. Die jüngsten Daten belegen, dass in Dänemark, Irland, Frankreich und Kroatien mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Methadon erfasst wurden als mit Heroin. Dies macht deutlich, dass in der klinischen Praxis Verfahren benötigt werden, die sicherstellen, dass Substitutions-Medikamente nicht abgezweigt werden.
Zu den in Europa ergriffenen Maßnahmen zur Prävention von Überdosierungen zählen unter anderem überwachte Drogenkonsumräume und die Ausgabe von Naloxon (einem Arzneimittel, das im Falle einer Überdosierung die Wirkung des Opioids umkehrt) an Opioidkonsumenten sowie deren Freunde und Familienangehörige. Überwachte Drogenkonsumräume gibt es mittlerweile in sechs EU-Ländern (DK, DE, ES, FR, LU, NL) und Norwegen (insgesamt 78 Einrichtungen in diesen sieben Ländern). Programme zur Ausgabe von Naloxon werden gegenwärtig in neun EU-Ländern (DK, DE, EE, IE, ES, FR, IT, LT, UK) und Norwegen durchgeführt.
Neue Drogen gelangen langsamer auf den Markt, die Verfügbarkeit bleibt jedoch insgesamt hoch
Neue psychoaktive Substanzen (NPS/‚neue Drogen‘) stellen in Europa nach wie vor eine beachtliche Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar. Sie werden vom internationalen Drogenkontrollsystem nicht erfasst und schließen ein breites Spektrum synthetischer Substanzen ein, darunter Cannabinoide, Cathinone, Opioide und Benzodiazepine.
Im Jahr 2016 wurden 66 neue psychoaktive Substanzen erstmals über das EU-Frühwarnsystem gemeldet – das entspricht einer Rate von mehr als einer Substanz pro Woche. Zwar weist diese Zahl darauf hin, dass sich das Tempo, mit dem neue Substanzen auf den Markt gebracht werden, verlangsamt – im Jahr 2015 wurden 98 Substanzen entdeckt –, jedoch ist die Gesamtzahl der derzeit verfügbaren Substanzen noch immer hoch. Ende 2016 überwachte die EMCDDA mehr als 620 neue psychoaktive Substanzen (gegenüber etwa 350 im Jahr 2013).
Die Tatsache, dass neue Substanzen in Europa nun in größeren Abständen entdeckt werden, ist möglicherweise auf eine ganze Reihe von Faktoren zurückzuführen. So wurden in einigen Mitgliedstaaten mithilfe neuer Rechtsvorschriften (z. B. pauschale Verbote, Kontrolle generischer und analoger Substanzen) restriktivere rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, angesichts derer es für die Hersteller unter Umständen weniger reizvoll ist, sich auf ein ‚Katz-und-Maus-Spiel‘ mit den Regulierungsbehörden einzulassen und immer neue Substanzen zu entwickeln, um der Kontrolle stets einen Schritt voraus zu sein. Auch die Strafverfolgungs- und Kontrollmaßnahmen, die in China gegen die Labors eingeleitet wurden, in denen neue Substanzen hergestellt werden, könnten zu dieser Verlangsamung beigetragen haben.
Im Jahr 2015 wurden über das EU-Frühwarnsystem fast 80.000 Sicherstellungen von neuen psychoaktiven Substanzen gemeldet. Synthetische Cannabinoide und synthetische Cathinone machten im Jahr 2015 gemeinsam mehr als 60 Prozent aller Sicherstellungen neuer Substanzen aus (mehr als 47.000). Im Juli 2016 wurde MDMB-CHMICA als erstes synthetisches Cannabinoid von der EMCDDA einer Risikobewertung unterzogen, nachdem über das EU-Frühwarnsystem schädliche Wirkungen (darunter etwa 30 Todesfälle) im Zusammenhang mit seinem Konsum gemeldet worden waren. Dies führte dazu, dass die Substanz im Februar 2017 europaweit Kontrollmaßnahmen unterworfen wurde.
Gemeinsam mit dem Europäischen Drogenbericht 2017 wurde eine neue Analyse zum Thema hochriskanter Drogenkonsum und neue psychoaktive Drogen („High-risk drug use and new psychoactive substances“) vorgelegt, deren Schwerpunkt auf dem problematischen Konsum neuer psychoaktiver Substanzen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen liegt.
Neue synthetische Opioide – hochpotent und eine zunehmende Gesundheitsgefahr
In Europa ebenso wie in Nordamerika stellen hochpotente synthetische Opioide, welche die Wirkungen von Heroin und Morphin imitieren, eine wachsende Gesundheitsgefahr dar. Sie haben zwar nur einen geringen Marktanteil, jedoch gibt es immer mehr Berichte über das Aufkommen dieser Substanzen und die von ihnen verursachten Schäden, darunter auch über nicht tödliche Vergiftungen und Todesfälle. Zwischen 2009 und 2016 wurden in Europa 25 neue synthetische Opioide entdeckt (darunter 18 Fentanyle).
Da für die Herstellung von vielen tausend Einzeldosen nur sehr geringe Mengen erforderlich sind, können neue synthetische Opioide problemlos versteckt und transportiert werden. Infolgedessen stellen diese Substanzen für die Drogenkontrollbehörden ein Problem und zugleich für die organisierte Kriminalität eine potenziell attraktive Ware dar. Sie liegen in unterschiedlichen Formen vor – zumeist als Pulver, Tabletten oder Kapseln –, wobei einige mittlerweile auch in flüssiger Form verfügbar sind und als Nasensprays verkauft werden.
Fentanyle werden besonders aufmerksam beobachtet. Diese Substanzen sind außergewöhnlich potent – in vielen Fällen potenter als Heroin – und machten mehr als 60 Prozent der 600 Sicherstellungen neuer synthetischer Opioide aus, die 2015 gemeldet wurden. Alleine 2016 wurden acht neue Fentanyle erstmals über das EU-Frühwarnsystem gemeldet. Diese Substanzen sind mit einer erheblichen Vergiftungsgefahr verbunden und zwar nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für all jene, bei denen es zu einer unbeabsichtigten Exposition (z. B. durch Hautkontakt oder Einatmen) kommen könnte, wie etwa die Mitarbeiter von Postdiensten, Zollbehörden und Rettungsdiensten.
Anfang 2017 nahm die EMCDDA Risikobewertungen von zwei Fentanylen (Acryloylfentanyl und Furanylfentanyl) vor, nachdem mehr als 50 Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Substanzen gemeldet worden waren. Für beide Substanzen wird gegenwärtig die Einführung von Kontrollmaßnahmen auf europäischer Ebene erwogen. Im Jahr 2016 gab die EMCDDA im Zusammenhang mit diesen und anderen neuen Fentanylen fünf Gesundheitswarnungen an ihr europaweites Netzwerk aus.
Hinweise auf eine steigende Verfügbarkeit von Kokain
Die in Europa am häufigsten konsumierten illegalen Stimulanzien sind Kokain, MDMA (in Tablettenform mitunter als ‚Ecstasy‘ bezeichnet) und Amphetamine (Amphetamin und Methamphetamin). Der Konsum von Kokain ist in den süd- und westeuropäischen Ländern höher – bedingt durch Einfuhrhäfen und Schmuggelrouten –, während in Nord- und Osteuropa der Konsum von Amphetaminen stärker verbreitet ist. Mit dem Aufkommen neuer Stimulanzien (z. B. Phenethylamine und Cathinone) ist der Markt für Stimulanzien in den letzten Jahren immer komplexer geworden.
Die Daten aus Abwasseranalysen, von Sicherstellungen, Preisen und Reinheit lassen darauf schließen, dass die Verfügbarkeit von Kokain in Teilen Europas einmal mehr im Steigen begriffen ist. Sowohl die Zahl der Sicherstellungen als auch die sichergestellte Menge sind zwischen 2014 und 2015 gestiegen. Im Jahr 2015 wurden in der EU etwa 87.000 Sicherstellungen von Kokain gemeldet (gegenüber 76.000 im Jahr davor), bei denen 69,4 Tonnen dieser Droge beschlagnahmt wurden (gegenüber 51,5 Tonnen im Jahr davor). Analysen der kommunalen Abwässer auf Kokainrückstände (Studie auf städtischer Ebene) haben gezeigt, dass in den meisten der 13 Städte, aus denen Daten für den Zeitraum zwischen 2011 und 2016 verfügbar sind, längerfristig eine stabile oder steigende Tendenz zu beobachten ist. Von den 33 Städten, aus denen Daten für 2015 und 2016 vorliegen, meldeten 22 einen Anstieg und vier einen Rückgang der Kokainrückstände, während sieben eine gleichbleibende Tendenz verzeichneten.
Etwa 17,5 Millionen erwachsene Europäer (zwischen 15 und 64 Jahren) haben mindestens einmal in ihrem Leben Kokain probiert. Darunter sind etwa 2,3 Millionen junge Erwachsene (zwischen 15 und 34 Jahren), die diese Droge in den zurückliegenden zwölf Monaten konsumiert haben. Den nationalen Erhebungen zufolge ist der Kokainkonsum seit 2014 im Wesentlichen stabil geblieben.
Welche Auswirkungen haben die globalen Entwicklungen in der Cannabispolitik auf Europa?
Die jüngsten Änderungen, die in Teilen Amerikas am Regulierungsrahmen für Cannabis vorgenommen wurden, wurden in Europa von politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit mit Interesse verfolgt. Dem Bericht zufolge können „die relativen Kosten und Vorteile der verschiedenen Ansätze der Cannabispolitik […] erst beurteilt werden, wenn diesbezüglich tragfähige Evaluierungen vorliegen“. In den 28 EU-Mitgliedstaaten werden gegenwärtig im Hinblick auf die Regulierung und den Konsum von Cannabis die unterschiedlichsten Ansätze verfolgt. Die Bandbreite reicht dabei von restriktiven Modellen bis hin zur Tolerierung bestimmter Formen des Eigengebrauchs. Bislang hat sich jedoch in Europa (EU-28, Norwegen und Türkei) noch keine nationale Regierung für eine umfassende legale Regulierung des Marktes für den Freizeitkonsum von Cannabis ausgesprochen.
Abgesehen von möglichen weiterreichenden Auswirkungen auf die Drogenpolitik stellt die Existenz kommerziell regulierter Cannabismärkte in einigen nichteuropäischen Ländern eine Triebkraft für Innovationen und Produktentwicklungen dar (z. B. bei Verdampfern, E-Liquids und essbaren Produkten), die sich letztlich auf die Konsummuster in Europa auswirken könnten. Angesichts dessen ist es dem Bericht zufolge umso wichtiger, diese Konsummuster zu beobachten und die möglichen gesundheitlichen Folgen etwaiger künftiger Veränderungen zu bewerten.
Etwa 87,7 Millionen erwachsene Europäer (zwischen 15 und 64 Jahren) haben mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis probiert. Darunter sind schätzungsweise 17,1 Millionen junge Europäer (zwischen 15 und 34 Jahren), die in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben. Etwa ein Prozent der europäischen Erwachsenen konsumiert täglich oder fast täglich Cannabis (d. h. sie haben die Droge an mindestens 20 Tagen des letzten Monats konsumiert). Die Ergebnisse der jüngsten Erhebungen zeigen, dass sich der Cannabiskonsum der letzten zwölf Monate in den einzelnen Ländern weiterhin unterschiedlich entwickelt hat. Cannabis wird nach wie vor mit Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht und ist in Europa (EU-28, Türkei und Norwegen) mittlerweile die Ursache für den Großteil (45 Prozent) der erstmaligen Behandlungsaufnahmen. Insgesamt ist die gemeldete Zahl der Personen, die erstmals wegen cannabisbedingter Probleme eine Behandlung aufnahmen, von 43.000 im Jahr 2006 auf 76.000 im Jahr 2015 gestiegen.
Download Europäischer Drogenbericht 2017
Download Länderbericht Deutschland 2017
Reitox Jahresbericht für Deutschland 2016
Pressestelle der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), 06.06.2017
 Männer, die illegale Drogen konsumieren, werden als Elternteil und Erziehungsverantwortliche sowohl in Forschung und Fachliteratur als auch in der Praxis weitgehend ignoriert. Um diese Lücke zu schließen, haben die Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRW, BELLA DONNA, und das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) eine Studie zum Thema „Problematischer Substanzkonsum und Vaterschaft“ durchgeführt und nun den Abschlussbericht vorgelegt. Die Studie steht auf der Homepage von BELLA DONNA und auf der Homepage des BMG zum Download bereit. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird im Folgenden aus dem Abschlussbericht zitiert:
Männer, die illegale Drogen konsumieren, werden als Elternteil und Erziehungsverantwortliche sowohl in Forschung und Fachliteratur als auch in der Praxis weitgehend ignoriert. Um diese Lücke zu schließen, haben die Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRW, BELLA DONNA, und das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) eine Studie zum Thema „Problematischer Substanzkonsum und Vaterschaft“ durchgeführt und nun den Abschlussbericht vorgelegt. Die Studie steht auf der Homepage von BELLA DONNA und auf der Homepage des BMG zum Download bereit. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird im Folgenden aus dem Abschlussbericht zitiert: