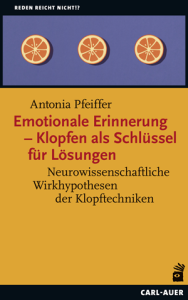Ein entscheidender Teil der Psychotherapie-Ausbildungsreform ist die neue Weiterbildung. Doch die Finanzierung der Weiterbildung ist nicht gesichert. Darauf machten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten am letzten Februar-Wochenende auf dem Berufspolitischen Seminar der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V. aufmerksam. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat Vorschläge für eine Zusatzfinanzierung gemacht, die das Bundesministerium für Gesundheit Anfang des Jahres abgelehnt hat. Eine Lösung sollte bis spätestens Ende des Jahres gefunden werden.
Die Reform der Psychotherapie-Ausbildung ist auf den Weg gebracht, die ersten Studierenden haben mit dem neuen Direktstudium Psychotherapie begonnen. „Doch ein entscheidendes Detail ist bei der Reform immer noch nicht geklärt“, betonte Dr. Rupert Martin, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V. auf dem Berufspolitischen Seminar der DGPT am 25./26. Februar: „Die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung – unverzichtbarer Teil der Ausbildungsreform – ist nicht gesichert.“
Die Reform der Psychotherapie-Ausbildung soll die Ausbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten an die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten angleichen. Wie das Medizinstudium mündet nun das neu eingeführte Direktstudium Psychotherapie in eine Approbation. Und analog zur Facharztausbildung schließt sich daran eine fünfjährige Weiterbildung zur/zum Fachpsychotherapeutin oder -therapeuten an, in der sich die Teilnehmenden auf mindestens ein wissenschaftlich anerkanntes Psychotherapieverfahren spezialisieren müssen. „Die Psychotherapeuten in Weiterbildung haben einen Anspruch auf ein angemessenes Gehalt, das ihrer Qualifikation mit Masterabschluss und Approbation entspricht“, sagte DGPT-Vorstand Dr. Martin. „Das ist ohne Zusatzfinanzierung für die ambulante Weiterbildung nicht kostendeckend möglich.“
Die Psychotherapeuten in Weiterbildung (PtW) werden an den Weiterbildungsstätten fest angestellt sein. Aus den Honoraren für die Weiterbildungsbehandlungen allein lassen sich die Anstellungsverhältnisse für die Weiterbildungsstätten jedoch nicht finanzieren: „Alle einschlägigen Berechnungen, so zum Beispiel von Wasem/Walendzik vom EsFoMed in Essen, gehen davon aus, dass man 20 bis 30 Prozent auf die Vergütung einer Behandlungsstunde draufrechnen müsste, damit die Kosten für die Weiterbildungsstätten gedeckt sind und die PtWs nicht Teile der Weiterbildung selber zahlen müssen“, so Dr. Martin. Finanzierungsvorschläge der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) vom Sommer 2022 hat das Bundesministerium für Gesundheit im Januar 2023 abgelehnt. Die BPtK hat nun eine konzertierte Aktion ins Leben gerufen, an der sich auch die DGPT beteiligt, um tragfähige Regelungen mit den politisch Verantwortlichen auszuhandeln. Bereits Ende des Jahres 2023 wird mit den ersten 1.000 Absolventinnen und Absolventen der neuen Studiengänge gerechnet, die dann mit der Weiterbildung beginnen werden.
Über die DGPT:
Die Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V. vertritt die Standes- und Berufsinteressen ihrer ca. 3.500 psychologischen und ärztlichen Mitglieder gegenüber der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen und gegenüber der Politik auf Bundesebene. Die DGPT versteht sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft und Berufsverband zugleich. Sie stellt Grundanforderungen für die Weiterbildung an 60 staatlich anerkannten Aus- und Weiterbildungsinstituten auf. Die DGPT ist der Spitzenverband der psychoanalytischen Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP), Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie e.V. (DGIP), Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) sowie des Netzwerks Freier Institute (NFIP).
Pressestelle der DGPT, 28.2.2023