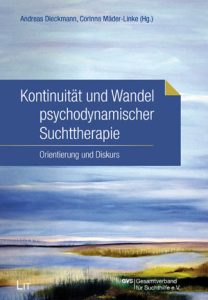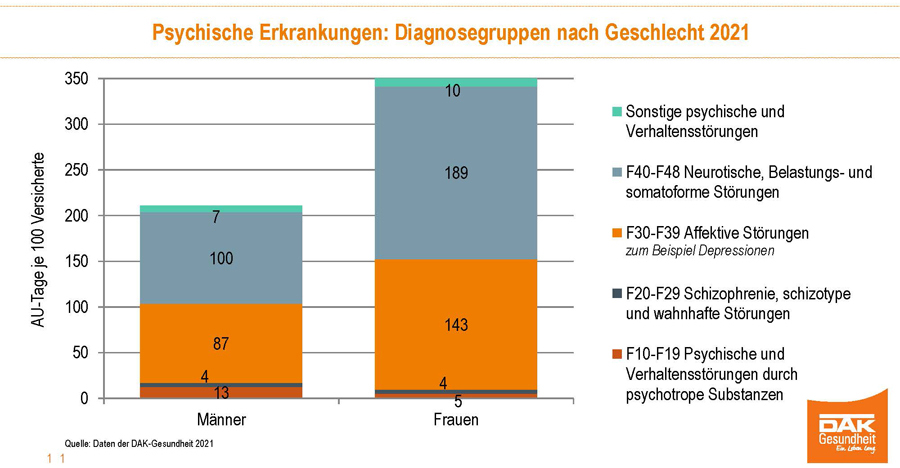Welche Trends gibt es beim Rauchen? Wie viel Alkohol trinkt die Bevölkerung in Deutschland? Was tut sich auf dem Glücksspiel-Markt? Diese und viele weitere Fragen rund um Sucht- & Drogen-Themen beantwortet das DHS Jahrbuch Sucht 2022. Neben der umfassenden Datensammlung, -aufbereitung, -analyse und -interpretation befasst sich die aktuelle Ausgabe des jährlich erscheinenden Standardwerks unter anderem mit Sucht und Suchtmittelkonsum unter Corona-Bedingungen.
Welche Trends gibt es beim Rauchen? Wie viel Alkohol trinkt die Bevölkerung in Deutschland? Was tut sich auf dem Glücksspiel-Markt? Diese und viele weitere Fragen rund um Sucht- & Drogen-Themen beantwortet das DHS Jahrbuch Sucht 2022. Neben der umfassenden Datensammlung, -aufbereitung, -analyse und -interpretation befasst sich die aktuelle Ausgabe des jährlich erscheinenden Standardwerks unter anderem mit Sucht und Suchtmittelkonsum unter Corona-Bedingungen.
Tabak
Im Jahr 2020 rauchten in Deutschland 24 Prozent der Frauen und 34 Prozent der Männer ab 18 Jahren. Allein 2018 starben hierzulande 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. „In der Tabakprävention und Tabakkontrollpolitik bleibt also noch viel zu tun. Die bisher umgesetzten Maßnahmen haben insbesondere bei jungen Menschen zu einem Rückgang des Rauchens geführt. Das ist erfreulich – aber bei weitem nicht genug“, sagt Christina Rummel, Geschäftsführerin der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) anlässlich des Erscheinens des DHS Jahrbuchs Sucht 2022.
Den Tabakkonsum nachhaltig zu verringern, ist ein wichtiges Ziel der Gesundheitspolitik. Um das zu erreichen, wurde im letzten Jahr die „Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040“ von einem breiten Bündnis von Gesundheits- und zivilgesellschaftlichen Organisationen veröffentlicht.
Trends beim Zigarettenkonsum
Der Konsum von Fertigzigaretten sank 2021 auf 71,8 Mrd. Stück (minus 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Damit liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 863 Zigaretten (2020: 888 Zigaretten). Das ist der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Rückläufig war auch der Feinschnitt-Konsum mit 24.854 Tonnen (minus 5,6 Prozent). Diese Menge entspricht etwa 37,3 Mrd. selbstgedrehten Zigaretten.
40 Prozent mehr (Wasser-)Pfeifentabak-Verbrauch
Dahingegen steigerte sich der Verbrauch von Zigarren/Zigarillos um plus 1,4 Prozent auf 2,8 Mrd. Stück im Jahr 2021. Beim (Wasser-)Pfeifentabak setzt sich der Trend der Vorjahre weiter fort: Der Konsum nahm um plus 40 Prozent auf 8.387 Tonnen deutlich zu. Zu begründen ist dies mit der anhaltenden Beliebtheit des speziellen Wasserpfeifentabaks, der vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Shishas geraucht wird.
Hohe gesamtwirtschaftliche Kosten
Im Jahr 2021 erhöhten sich die Konsumausgaben für Tabakprodukte auf 29,4 Mrd. Euro (plus 2,0 Prozent). Die Einnahmen aus der Tabaksteuer stiegen leicht: um plus 0,5 Prozent auf 14,7 Mrd. Euro.
Die gesamtwirtschaftlichen Kosten, die auf das Rauchen zurückgehen, belaufen sich aktuellen Schätzungen zufolge in Deutschland auf 97,24 Mrd. Euro jährlich. Die direkten Kosten (z. B. für die Behandlung tabakbedingter Krankheiten) betrugen 30,32 Mrd. Euro; die indirekten Kosten (z. B. Produktivitätsausfälle) beliefen sich auf 66,92 Mrd. Euro (in 2018).
Alkohol
Deutschland bleibt im internationalen Vergleich weiterhin ein Hochkonsumland für Alkohol – obwohl hierzulande der Verbrauch an alkoholischen Getränken gegenüber dem Vorjahr und auch längerfristig sank: Von 14,4 Litern Reinalkohol im Jahr 1970 auf 10,2 Liter im Jahr 2019 pro Bundesbürger:in ab 15 Jahren.
In Deutschland wird zu viel Alkohol getrunken
In einer Statistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nahm Deutschland im Jahr 2019 beim Alkoholkonsum unter 44 Nationen die 13. Position ein. Damit liegt der Verbrauch hierzulande deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder pro Bürger:in ab 15 Jahren.
62.000 alkoholbedingte Todesfälle
In Deutschland starben 19.000 Frauen und 43.000 Männer an einer alkoholbezogenen Todesursache. Das entspricht vier Prozent aller Todesfälle unter Frauen und 9,9 Prozent aller Todesfälle unter Männern (Zahlen für 2016). „Alkohol ist ein Zellgift. Zahlreiche körperliche Erkrankungen, z. B. der Leber und auch Krebserkrankungen, sind auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen“, so Prof. Dr. Norbert Scherbaum, Vorstandsvorsitzender der DHS.
Alkoholkonsum: Weniger ist besser!
„Forschungsergebnisse belegen: Es gibt keine gesundheitsförderliche Wirkung bestimmter alkoholischer Getränke oder geringer bis moderater Trinkmengen. Daher gilt in puncto Alkohol der Grundsatz: Weniger ist besser!“, erläutert Christina Rummel.
Glücksspiel
Die Umsätze (Spieleinsätze) auf dem legalen deutschen Glücksspielmarkt gingen in 2020 auf 38,3 Mrd. Euro zurück (minus 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Als größtes Marktsegment verzeichneten die rund 220.000 aufgestellten gewerblichen Geldspielautomaten in Spielhallen und gastronomischen Betrieben einen Rückgang des Umsatzes und Bruttospielertrags um 25,5 Prozent auf 17,9 Mrd. Euro bzw. 4,1 Mrd. Euro.
Bruttospielerträge gesunken
Die Bruttospielerträge des regulierten deutschen Glücksspielmarktes erreichten im Jahr 2020 ein Volumen von 10,112 Mrd. Euro (minus 8,7 Prozent). Auf dem nicht-regulierten (unerlaubten) Markt wurde ein geschätzter Ertrag von 1,568 Mrd. Euro erzielt (minus 29 %). Die glücksspielbezogenen Einnahmen des Staates aus erlaubten Angeboten lagen 2020 bei 5,341 Mrd. Euro (minus 1,3 Prozent).
Sucht und Corona
„Die Corona-Pandemie hat die psychische Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland stark beeinträchtigt. Wir wissen aus anderen Krisensituationen, dass Menschen vermehrt Suchtmittel und süchtiges Verhalten nutzen – mit dem Wunsch, Belastungen in schwierigen Zeiten auszugleichen. Daraus lässt sich allerdings nicht schlussfolgern, die Einwohnerinnen und Einwohner von Deutschland wären durch die Coronakrise süchtiger geworden. Dazu ist die Datenlage aktuell noch zu dünn“, sagt Christine Kreider, Referentin für Prävention bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS).
Weniger Alkohol außer Haus
Während der Corona-Pandemie waren Gaststätten zeitweilig geschlossen. Zahlreiche Volksfeste und gesellige Veranstaltungen fielen aus. Und damit auch Gelegenheiten, um außer Haus Alkohol zu trinken. Die Zahl der Alkoholunfälle ging im Jahr 2020 besonders stark zurück (minus 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Dies lässt sich auf das veränderte Mobilitätsverhalten während der COVID-19-Pandemie zurückführen.
Teile der Bevölkerung besonders betroffen
Grundsätzlich ist aus der Perspektive der Suchthilfe zu beobachten: Die Corona-Pandemie ist vor allem für jene Menschen eine große Belastung, die bereits zuvor psychosozialen oder gesundheitlichen Problemen ausgesetzt waren. So führte die Krise beispielsweise bei Menschen, deren Alkoholkonsum schon vor der Pandemie problembehaftet war, zu einer Ausweitung des Konsums in Coronazeiten. Prävention, Frühintervention, Beratung, Behandlung und Sucht-Selbsthilfe braucht es daher nun umso mehr, um Suchtgefährdete und Abhängigkeitserkrankte zu unterstützen.
Entwicklung von Suchterkrankungen
Aktuell ist es jedoch kaum möglich, Aussagen über einen möglichen Anstieg von Abhängigkeitserkrankungen zu treffen. „Für solche Erkenntnisse ist die Pandemie vergleichsweise ‚jung‘“, erläutert Christine Kreider. „Abhängigkeitserkrankungen entstehen zumeist schleichend über einen längeren Zeitraum. In den Statistiken bilden sie sich daher erst zeitverzögert ab. Fest steht allerdings schon jetzt: Wir müssen uns mehr denn je um besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen kümmern, wie beispielsweise Kinder aus Suchtfamilien.“
Das Jahrbuch Sucht 2022 ist im Verlag Pabst Science Publishers erschienen.
Pressestelle der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), 26.4.2022