 Der rasche Wandel auf dem europäischen Drogenmarkt schafft neue Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und stellt die Reaktionsfähigkeit der EU auf den Prüfstand. Diese Warnung spricht die Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA) in ihrem „Europäischen Drogenbericht 2025: Trends und Entwicklungen“ aus, der am 5.6.2025 veröffentlicht wurde. Anhand von Daten aus 29 Ländern (EU-27, Norwegen und der Türkei) aus dem Jahr 2023 oder dem neuesten verfügbaren Jahr werden die neuesten Trends und neu aufkommende Bedrohungen aufgezeigt. Der Bericht steht (vorläufig nur auf Englisch) auf der Website der EUDA zur Verfügung. Wer tiefer in die europäischen Daten einsteigen möchte, kann sich im ebenfalls neu erschienenen Statistischen Bulletin informieren.
Der rasche Wandel auf dem europäischen Drogenmarkt schafft neue Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und stellt die Reaktionsfähigkeit der EU auf den Prüfstand. Diese Warnung spricht die Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA) in ihrem „Europäischen Drogenbericht 2025: Trends und Entwicklungen“ aus, der am 5.6.2025 veröffentlicht wurde. Anhand von Daten aus 29 Ländern (EU-27, Norwegen und der Türkei) aus dem Jahr 2023 oder dem neuesten verfügbaren Jahr werden die neuesten Trends und neu aufkommende Bedrohungen aufgezeigt. Der Bericht steht (vorläufig nur auf Englisch) auf der Website der EUDA zur Verfügung. Wer tiefer in die europäischen Daten einsteigen möchte, kann sich im ebenfalls neu erschienenen Statistischen Bulletin informieren.
In dieser 30. Ausgabe des Berichts wird aufgezeigt, wie sich der europäische Drogenmarkt ständig weiterentwickelt und wie sich Drogenhändler und Drogenkonsum an die geopolitische Instabilität, die Globalisierung und die technologischen Fortschritte anpassen. In dem Bericht wird zudem vor Risiken für die öffentliche Gesundheit gewarnt, die von der Verfügbarkeit und dem Konsum eines immer vielfältigeren Spektrums von Substanzen ausgehen, die häufig einen hohen Wirkstoffgehalt und einen hohen Reinheitsgrad aufweisen. Der polyvalente Drogenkonsum gibt nach wie vor Anlass zur Sorge und erschwert die wirksame Durchführung von Maßnahmen zur Prävention, Behandlung und Schadensminimierung.
Die EUDA unterstützt die EU und ihre Mitgliedstaaten darin, neue drogenbedingte Herausforderungen vorherzusehen und darauf zu reagieren. Dabei setzt sie auf eine Reihe neuer Aktivitäten, etwa gezielte Warnmeldungen, zeitnahe Bedrohungsanalysen, die Nachverfolgung von Drogenausgangsstoffen und eingehende forensische und toxikologische Analysen. Zu den neuen Bedrohungen, die in dem Bericht aufgezeigt werden und auf die die Mitgliedstaaten vorbereitet sein müssen, gehören synthetische Cathinone, hochwirksame synthetische Opioide und starke Cannabisprodukte.

Der europäische Markt für Stimulanzien: Cathinone auf dem Vormarsch
In dem Bericht wird auf die gestiegene Verfügbarkeit von synthetischen Cathinonen aufmerksam gemacht, die sich in „noch nie dagewesenen Einfuhren und Beschlagnahmungen“ niederschlägt. Dabei handelt es sich um synthetische Stimulanzien, die chemisch dem Cathinon, dem Wirkstoff von Khat, ähneln. Im Jahr 2023 wurden insgesamt mindestens 37 Tonnen synthetischer Cathinone gemeldet (im Jahr 2022 waren es noch 27 Tonnen und 2021 lag die Zahl bei 4,5 Tonnen). Dabei handelte es sich hauptsächlich um eine kleine Anzahl von Einfuhren sehr großer Mengen aus Indien, vor allem über die Niederlande.
Im Rahmen des EU-Frühwarnsystems (EWS) für neue psychoaktive Substanzen (NPS) wurden im Jahr 2024 sieben neue synthetische Cathinone identifiziert, womit sich die Gesamtzahl dieser Substanzen, die in Europa unter Beobachtung stehen, auf 178 erhöht. Vor Kurzem hat die EUDA Risikobewertungen für drei neue synthetische Cathinone durchgeführt: für 2-Methylmethcathinon (2-MMC), 4-Bromomethcathinon (4-BMC) und N-Ethylnorpentedron (NEP). Im Januar 2025 legte die Agentur die erste EU-weite Risikobewertung für acht chemische Grundstoffe vor, die zur Herstellung synthetischer Cathinone verwendet werden.
Während der ungewollte Konsum synthetischer Cathinone in Drogengemischen und Tabletten nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, kaufen Konsumierende diese Substanzen durchaus auch bewusst als favorisiertes Stimulans. Auch die Behandlungsdaten spiegeln die wachsende Präsenz von synthetischen Cathinonen wider, wobei eine erhöhte Zahl der erstbehandelten Patient:innen in den Ländern, aus denen diese Daten stammen, zu verzeichnen ist (ein Anstieg von 425 Patient:innen im Jahr 2018 auf 1.930 im Jahr 2023).
Im Jahr 2023 wurden 53 Produktionsstätten für synthetische Cathinone, darunter einige große Anlagen, in der EU, vor allem in Polen, ausgehoben (zum Vergleich: 2022 waren es 29). Dies ist ein Beispiel für die Intensivierung der Drogenproduktion in Europa. Im Jahr 2023 wurden von den Behörden Produktionsanlagen in ganz Europa ausgehoben, darunter: 250 Anlagen für Methamphetamin, 93 für Amphetamin, 36 für MDMA und 34 für Kokain.
Neue synthetische Opioide: Nitazene bergen eine hohe Gefahr von Vergiftungen mit Todesfolge
Schätzungen der EUDA zufolge waren im Jahr 2023 7.500 drogenbedingte Todesfälle zu verzeichnen (gegenüber etwa 7.100 im Jahr zuvor), die hauptsächlich Opioide in Kombination mit anderen Substanzen betrafen. Der europäische Opioidmarkt entwickelt sich immer weiter, sodass neben Heroin inzwischen auch andere Substanzen erhältlich sind. Neue synthetische Opioide (synthetische Substanzen, die an die Opioidrezeptoren im Gehirn binden und in ihrer Wirkung weitgehend mit Heroin vergleichbar sind) spielen auf dem europäischen Drogenmarkt im Großen und Ganzen eine eher untergeordnete Rolle. In den baltischen Ländern hingegen sind sie überdurchschnittlich präsent. Doch auch in anderen EU-Mitgliedstaaten wachsen die Bedenken hinsichtlich ihrer Verwendung. Im Jahr 2024 veröffentlichte die EUDA einen Aufruf mit der Aufforderung an die Partner und Mitgliedstaaten der EU, gemeinsam gegen die wachsende Bedrohung vorzugehen, die von neuen synthetischen Opioiden ausgeht.
Seit 2009 sind insgesamt 88 neue synthetische Opioide auf dem europäischen Markt in Erscheinung getreten. Diese sind oft hochwirksam, sodass erhöhte Vergiftungs- und Sterblichkeitsrisiken bestehen. Im Jahr 2024 handelte es sich bei allen sieben neuen synthetischen Opioiden, die über das EWS offiziell gemeldet wurden, um Nitazene. Aktuell stehen in Europa 22 Nitazene unter Beobachtung. Aus einer Bedrohungsanalyse, die von der EUDA kürzlich als Pilotprojekt mit Schwerpunkt auf neuen synthetischen Opioiden in den baltischen Staaten durchgeführt wurde, geht hervor, dass Nitazene für einen erheblichen Teil der Todesfälle durch Überdosierung in Estland und Lettland verantwortlich waren. Im Jahr 2024 meldeten mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten und Norwegen Probleme im Zusammenhang mit Nitazen.
In dem Bericht wird auf die gestiegene Verfügbarkeit gefälschter Arzneimittel aufmerksam gemacht, die Nitazene enthalten und mit denen in der Regel legale verschreibungspflichtige Arzneimittel (z. B. Oxycodon, Benzodiazepine) nachgeahmt werden. Dies ruft Bedenken hervor, dass diese Produkte von einem größeren Konsumentenkreis, darunter jungen Menschen, verwendet werden könnten.
Aufgrund der hohen Wirksamkeit von Nitazenen bergen diese gefälschten Arzneimittel ein erhebliches Risiko für schwere Vergiftungen und Überdosierungen. Eine der wichtigsten Gegenmaßnahmen bei einer opioidbedingten Überdosierung ist die Verabreichung von Naloxon durch medizinisches Fachpersonal oder im Rahmen von Programmen zur Naloxon-Mitgabe (THN). Immer mehr Länder bieten THN-Programme an (im Jahr 2023 waren es 15 EU-Mitgliedstaaten, 2024 begannen drei weitere mit entsprechenden Pilotprogrammen).
Dass in China zehn Nitazene reguliert werden, könnte zu einer Marktverschiebung führen – weg von Nitazenen (z. B. Metonitazen, Protonitazen) hin zu neuartigen Derivaten oder alternativen Opioiden. Im Jahr 2024 wurden im Rahmen des Frühwarnsystems Substanzen aus der Familie der „Orphine“ (z. B. Cychlorphin, Spirochlorphin) identifiziert, was aufzeigt, dass eine genaue Beobachtung nötig ist.
Es wird vermutet, dass eine künftige Heroinknappheit in Europa infolge des von den Taliban verhängten Verbots des Opiummohn-Anbaus und der Opiumproduktion in Afghanistan dazu führen könnte, dass Marktlücken in Europa durch synthetische Opioide geschlossen werden. Ebenso könnten sich aber auch Stimulanzien wie Kokain und synthetische Cathinone als Heroinersatz etablieren. In dem Bericht heißt es: „Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten muss Europa seine Reaktionsfähigkeit verbessern, was die potenziellen Herausforderungen anbelangt, die sich aus einer solchen Marktverschiebung ergeben.“
Hochwirksame Cannabis-Produkte und größere Verfügbarkeit von halbsynthetischen Cannabinoiden
Die Entwicklungen auf dem Cannabismarkt gehen mit neuen Herausforderungen für die Länder einher, was ihre Gegenmaßnahmen zum Umgang mit dieser am häufigsten konsumierten illegalen Droge in Europa anbelangt – Schätzungen zufolge haben in den letzten zwölf Monaten 24 Millionen erwachsene Europäer:innen (im Alter von 15 bis 64 Jahren) Cannabis konsumiert. Der durchschnittliche THC-Gehalt von Cannabisharz hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und betrug im Jahr 2023 bereits 23 Prozent, während Cannabiskraut einen nur halb so hohen THC-Gehalt aufwies (stabil bei elf Prozent). Heutzutage wird die Bewertung der cannabisbedingten Gesundheitsrisiken durch das breitere Angebot an verfügbaren Produkten, darunter hochwirksame Extrakte und Edibles, merklich erschwert.
Einige Produkte, die auf dem illegalen Markt als Cannabis verkauft werden, können mit hochwirksamen neuen synthetischen Cannabinoiden versetzt sein, ohne dass die Konsumierenden davon wissen. Diese Substanzen ahmen die Wirkung von THC, dem wichtigsten psychoaktiven Wirkstoff von Cannabis, nach (und binden an dieselben Rezeptoren im Gehirn). Aufgrund der Regulierung synthetischer Cannabinoide in China seit 2021 ist die Verfügbarkeit dieser Substanzen in Europa zurückgegangen. Die Verfügbarkeit von halbsynthetischen Cannabinoiden (die aus CBD, einem anderen Wirkstoff der Hanfpflanze, hergestellt werden können), etwa Hexahydrocannabinol (HHC), das kürzlich internationalen Kontrollmaßnahmen unterworfen wurde, ist jedoch gestiegen. Im Jahr 2024 waren 18 der 20 neuen Cannabinoide, die über das Frühwarnsystem nachgewiesen wurden, halbsynthetisch. Im Juni 2024 meldete Ungarn Massenvergiftungen mit 30 akuten, nicht tödlich verlaufenden Fällen im Zusammenhang mit „Gummibärchen“, die hochwirksame halbsynthetische Cannabinoide enthielten.
Auf politischer Ebene haben mehrere EU-Mitgliedstaaten (z. B. Deutschland, Luxemburg, Malta und die Niederlande) ihr Konzept zur Regulierung des Gebrauchs von Cannabis als Freizeitdroge geändert oder stellen eine Änderung in Aussicht. Diese Änderungen betreffen neue Vorschriften für den privaten Eigenanbau, nicht-gewerblich betriebene Clubs/Anbauvereine und den Cannabiskonsum im privaten Bereich.
Die EUDA betont, dass diese Entwicklungen beobachtet und bewertet werden müssen, um die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, die Sicherheit und den Binnenmarkt vollständig zu verstehen.
Kokain: zunehmende gesundheitliche Auswirkungen und hohe Verfügbarkeit
Kokain ist das in Europa am häufigsten konsumierte illegale Stimulans und wurde im letzten Jahr von etwa 4,6 Millionen der europäischen Erwachsenen (im Alter von 15 bis 64 Jahren) eingenommen. Die Bedenken hinsichtlich der negativen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit nehmen zu. Kokain ist die am zweithäufigsten gemeldete illegale Droge bei Personen, die sich erstmals in Drogentherapie begeben (35.000 im Jahr 2023 gegenüber 31.500 im Jahr zuvor). Daten aus Euro-DEN Plus Sentinel-Krankenhäusern aus dem Jahr 2023 deuten darauf hin, dass Kokain die am häufigsten gemeldete Substanz bei Personen ist, die in Notaufnahmen von Krankenhäusern behandelt werden. Es war in 25 Prozent (1.695) der Fälle akuter Drogenvergiftung beteiligt. Sowohl der injizierende Kokainkonsum als auch der Konsum von Crack werden in einer wachsenden Zahl von Ländern beobachtet. 2023 gab es schätzungsweise 9.900 Therapieaufnahmen im Zusammenhang mit Crack (8.100 im Jahr 2022).
Die anhaltend hohe Verfügbarkeit von Kokain in Europa wird von den Daten über Sicherstellungen belegt. Im siebten Jahr in Folge beschlagnahmten die EU-Mitgliedstaaten Rekordmengen an Kokain: Im Jahr 2023 wurden 419 Tonnen sichergestellt (2022 waren es noch 323 Tonnen). Fast drei Viertel (72 Prozent) der beschlagnahmten Gesamtmenge entfielen auf Belgien (123 Tonnen), Spanien (118 Tonnen) und die Niederlande (59 Tonnen), womit deren Rolle als wichtigste Schleusen für die Einfuhr von Kokain nach Europa deutlich wird (vorläufige Daten für 2024 deuten auf eine Änderung der Situation hin). Auch andere Länder werden als Einfuhrschleusen ins Visier genommen, so z. B. Deutschland (43 Tonnen), Frankreich (23 Tonnen) und Portugal (22 Tonnen).
Die Beschlagnahmen großer Mengen in den europäischen Häfen zeigen, wie illegale Drogenhändler nach wie vor kommerzielle Lieferketten für ihre Zwecke nutzen. Im Jahr 2024 meldete Spanien seinen bislang größten Fall sichergestellten Kokains (13 Tonnen), das in einer Bananenlieferung mit Ursprung in Ecuador versteckt war. Im Rahmen des EU-Fahrplans zur Bekämpfung des Drogenhandels und der organisierten Kriminalität zielt die Europäische Hafenallianz darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Häfen gegen den Drogenhandel und gegen die kriminelle Unterwanderung zu stärken.
Der Wettbewerb auf dem illegalen Drogenmarkt leistet der Kriminalität im Zusammenhang mit Kokain, einschließlich Bandenkriminalität und Tötungsdelikten, Vorschub. Im Anschluss an die erste europäische Konferenz zum Thema drogenbedingte Gewalt veröffentlichte die EUDA im Jahr 2024 einen Aufruf zum Handeln, um die Spirale dieser Form der Gewalt zu durchbrechen. Dabei wurde betont, wie dringend eine sektorübergreifende Zusammenarbeit erforderlich ist, um mehr Sicherheit in Europa zu schaffen.
Verschiedene Datenquellen, z. B. Abwasseranalysen, deuten darauf hin, dass sich die in den letzten Jahren stetig zunehmende Verfügbarkeit von Kokain in der EU auf den Konsum dieser Droge auswirkt. In mehr als der Hälfte der Städte, aus denen Daten für 2023 und 2024 verfügbar sind, war eine Zunahme der Kokainrückstände im kommunalen Abwasser festzustellen. Da die geschätzte Zeitspanne zwischen dem ersten Kokainkonsum und dem ersten Aufsuchen einer Therapieeinrichtung etwa 13 Jahre beträgt, könnte sich die gestiegene Verfügbarkeit in einigen Jahren in einer wachsenden Nachfrage nach einer Therapie niederschlagen. Dies erfordert eine dringende Bewertung der Reaktionskapazitäten der EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf einen möglichen Anstieg der Nachfrage nach Therapieplätzen.
Stärkung der Reaktionsfähigkeit der EU im Drogenbereich: neue EUDA-Aktivitäten
Um Europa bei der Bewältigung der immer komplexer werdenden Drogenproblematik zu unterstützen, entwickelt die EUDA eine Reihe neuer integrierter Aktivitäten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf vier Schlüsselbereichen: 1) Antizipation aufkommender drogenbedingter Herausforderungen und ihrer Folgen, 2) Echtzeit-Warnungen bei neuen Drogenrisiken und Drogenbedrohungen, 3) Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten beim Ausbau ihrer Gegenmaßnahmen und 4) Förderung des EU-weiten Wissens- und Erfahrungsaustauschs über evidenzbasierte Drogenstrategien und Drogenmaßnahmen.
Derzeit werden neue Initiativen wie ein Europäisches Drogenwarnsystem und ein System zur Bewertung der Gefahrenlage bezüglich Gesundheit und Sicherheit entwickelt, um die Frühwarnung zu verbessern und das Lagebewusstsein zu schärfen. In der Zwischenzeit werden im Rahmen eines Europäischen Netzes kriminaltechnischer und toxikologischer Labore Drogenproben analysiert, Expert:innen geschult und Informationen über neue Entwicklungen ausgetauscht, z. B. über die Gefahren, die von neuen synthetischen Opioiden ausgehen. Ferner wurde der Agentur eine neue Rolle zugewiesen: Sie soll die Mitgliedstaaten über neue Entwicklungen bei der Erhebung und Analyse von Informationen über Drogenausgangsstoffe, über deren Abzweigung und illegalen Handel informieren und die Europäische Kommission in Form der Bereitstellung wissenschaftlicher Daten unterstützen. Zusammen werden diese Bemühungen eine solide Grundlage für eine nachhaltigere europäische Reaktion auf das Drogenproblem bilden.
Pressemitteilung der EUDA European Union Drugs Agency, 5.6.2025


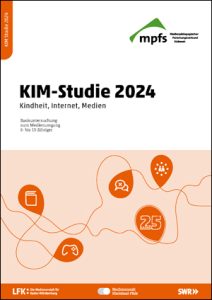

 Der rasche Wandel auf dem europäischen Drogenmarkt schafft neue Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und stellt die Reaktionsfähigkeit der EU auf den Prüfstand. Diese Warnung spricht die Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA) in ihrem „Europäischen Drogenbericht 2025: Trends und Entwicklungen“ aus, der am 5.6.2025 veröffentlicht wurde. Anhand von Daten aus 29 Ländern (EU-27, Norwegen und der Türkei) aus dem Jahr 2023 oder dem neuesten verfügbaren Jahr werden die neuesten Trends und neu aufkommende Bedrohungen aufgezeigt. Der Bericht steht (vorläufig nur auf Englisch) auf der
Der rasche Wandel auf dem europäischen Drogenmarkt schafft neue Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und stellt die Reaktionsfähigkeit der EU auf den Prüfstand. Diese Warnung spricht die Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA) in ihrem „Europäischen Drogenbericht 2025: Trends und Entwicklungen“ aus, der am 5.6.2025 veröffentlicht wurde. Anhand von Daten aus 29 Ländern (EU-27, Norwegen und der Türkei) aus dem Jahr 2023 oder dem neuesten verfügbaren Jahr werden die neuesten Trends und neu aufkommende Bedrohungen aufgezeigt. Der Bericht steht (vorläufig nur auf Englisch) auf der 
 Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, 28. Mai 2025, den Vorschlägen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken entsprochen und Prof. Dr. Hendrik Streeck (CDU), Katrin Staffler (CSU) und Stefan Schwartze (SPD) als Beauftragte der Bundesregierung berufen. Die Beauftragten sind im Geschäftsbereich des BMG angesiedelt.
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, 28. Mai 2025, den Vorschlägen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken entsprochen und Prof. Dr. Hendrik Streeck (CDU), Katrin Staffler (CSU) und Stefan Schwartze (SPD) als Beauftragte der Bundesregierung berufen. Die Beauftragten sind im Geschäftsbereich des BMG angesiedelt.