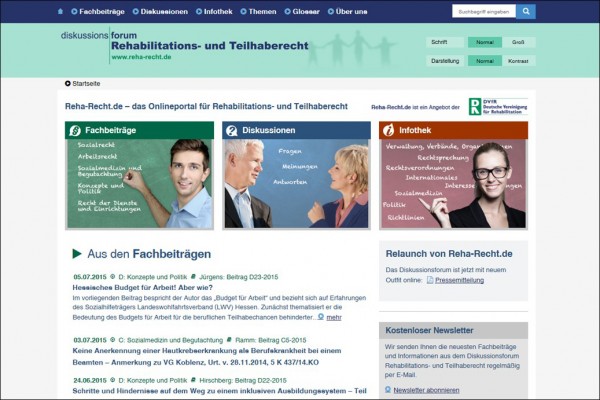Medizin gilt als eines der Fächer, in dem die Studierenden besonders gefordert werden. Das bleibt nicht ohne Folgen: Dramatisch viele Medizinstudierende zeigen schon im Grundstudium Symptome von stressbedingten Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Das belegen aktuelle Studien von Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Die Forscher vermitteln aber auch Strategien, wie die Studierenden schon frühzeitig lernen können, stressbedingten Risikofaktoren vorzubeugen.
„Uns ist aufgefallen, dass unsere Studierenden in Sprechstunden mit ihren Dozenten über die Jahre mehr und mehr von Stress und Prüfungsangst berichteten“, sagen die Leiter der Studie, Prof. Dr. Michael Scholz vom Institut für Anatomie der FAU und Dr. Pascal Burger von der psychiatrischen und psychotherapeutischen Spezialklinik Meissenberg im schweizerischen Zug. Deshalb haben die FAU-Forscher in ihrer Studie mehrere Jahrgänge von Medizinstudierenden vom Start an der Universität bis zum ersten Staatsexamen am Ende des vierten Semesters untersucht. Dazu haben die Studierenden Fragebögen zu verschiedenen Aspekten ihrer mentalen Befindlichkeit ausgefüllt, die anschließend wissenschaftlich ausgewertet wurden.
Das Ergebnis: Zu Beginn des Studiums entspricht der Gesundheitszustand der angehenden Mediziner dem der Normalbevölkerung. Mit steigender Semesterzahl nehmen jedoch Depressivität, Ängstlichkeit und Burnout-Beschwerden deutlich zu. Am Ende des zweiten Studienjahres war die Zahl der zumindest leicht depressiven Studierenden fast doppelt so hoch wie bei den Studienanfängern. Gleichzeitig waren immer weniger Studierende in der Lage, Abstand zu den Belastungen des Studiums zu gewinnen, lernten zum Beispiel Tage und Wochen am Stück ohne große Pausen, und liefen dadurch vermehrt Gefahr auszubrennen. Je ausgeprägter dieses Lernverhalten war, desto ausgeprägter waren Stresssymptome der Studierenden.
Die Schlussfolgerung der Erlanger Forscher: „Wer angehenden Ärzten beibringt, die Gesundheit von Patienten zu steuern, muss ihnen auch beibringen, den eigenen Stress zu managen.“ Schließlich müssen sich Mediziner bereits von Anfang an im Studium und auch später im Beruf großen psychischen Belastungen stellen. Wie wirkungsvoll bestimmte Stressbewältigungstechniken sind, haben die FAU-Mediziner in einer weiteren Studie untersucht. Dabei erhielten Studierende im Rahmen eines Wahlfaches Einführungen in die Anwendung von Entspannungstechniken wie zum Beispiel Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung. Ziel war es, den Studierenden diese Techniken so beizubringen, dass sie sie selbstständig und regelmäßig anwenden können. Die Ergebnisse waren eindeutig: Die mentale Befindlichkeit der Teilnehmer besserte sich nach Kursabschluss deutlich.
„Obwohl an unseren Studien nur Studierende der Universität Erlangen-Nürnberg teilgenommen haben, sind unsere Ergebnisse auch auf andere Universitäten übertragbar, zumal internationale und an anderen deutschen Hochschulstandorten durchgeführte Studien durchaus vergleichbare Resultate erbrachten“, erklärt Prof. Scholz. Aufgrund ihrer Ergebnisse planen die Forscher, ein Wahlfach zum Erlernen von Entspannungstechniken zur Stressbewältigung für Medizinstudierende ab dem nächsten Wintersemester regelmäßig anzubieten.
Pressestelle der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 26.06.2015