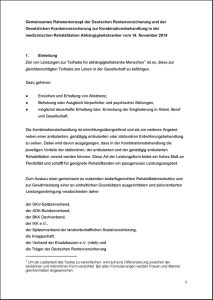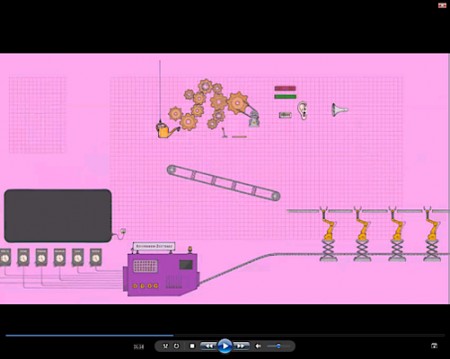Knapp drei Millionen Deutsche haben verschreibungspflichtige Medikamente genutzt, um am Arbeitsplatz leistungsfähiger zu sein oder um Stress abzubauen. Das geht aus dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport „Update: Doping am Arbeitsplatz“ hervor. Ein zentrales Ergebnis: Die Anzahl der Arbeitnehmer, die entsprechende Substanzen schon zum Doping missbraucht haben, ist in den vergangenen sechs Jahren stark gestiegen – von 4,7 auf 6,7 Prozent. Vor allem Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten oder unsicheren Jobs gehören zu den Risikogruppen für den Medikamentenmissbrauch.
Knapp drei Millionen Deutsche haben verschreibungspflichtige Medikamente genutzt, um am Arbeitsplatz leistungsfähiger zu sein oder um Stress abzubauen. Das geht aus dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport „Update: Doping am Arbeitsplatz“ hervor. Ein zentrales Ergebnis: Die Anzahl der Arbeitnehmer, die entsprechende Substanzen schon zum Doping missbraucht haben, ist in den vergangenen sechs Jahren stark gestiegen – von 4,7 auf 6,7 Prozent. Vor allem Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten oder unsicheren Jobs gehören zu den Risikogruppen für den Medikamentenmissbrauch.
Für die repräsentative Studie wurde untersucht, ob und wie Erwerbstätige ohne medizinische Notwendigkeit zu verschreibungspflichtigen Medikamenten greifen. Experten nennen dies pharmakologisches Neuro-Enhancement. Hierfür hat die DAK-Gesundheit Arzneimitteldaten von 2,6 Millionen erwerbstätigen Versicherten analysiert und zusätzlich mehr als 5.000 Berufstätige im Alter von 20 bis 50 Jahren befragt. Demnach haben 6,7 Prozent der Berufstätigen, also knapp drei Millionen Menschen, das so genannte Hirndoping wenigstens schon einmal praktiziert. Bei einem vergleichbaren DAK-Report 2008 waren es noch 4,7 Prozent. Nach den Ergebnissen des DAK-Gesundheitsreports 2015 gibt es zudem eine hohe Dunkelziffer von bis zu zwölf Prozent. Hochgerechnet auf die Bevölkerung haben damit fünf Millionen Erwerbstätige schon einmal leistungssteigernde oder stimmungsaufhellende Medikamente zum Hirndoping eingenommen. Und: Unter den übrigen Erwerbstätigen ist jeder Zehnte für diese Form des Hirndopings prinzipiell aufgeschlossen. Regelmäßig dopen sich laut Studie knapp eine Millionen Berufstätige (1,9 Prozent). „Auch wenn Doping im Job in Deutschland noch kein Massenphänomen ist, sind diese Ergebnisse ein Alarmsignal“, warnt DAK-Vorstandschef Herbert Rebscher. „Suchtgefahren und Nebenwirkungen des Hirndopings sind nicht zu unterschätzen. Deshalb müssen wir auch beim Thema Gesundheit vorausschauen und über unsere Wertvorstellungen und Lebensstilfragen diskutieren.“
Männer wollen mehr Leistung, Frauen emotionale Stabilität
Auslöser für den Griff zur Pille sind meist hoher Leistungsdruck sowie Stress und Überlastung. Vier von zehn Dopern gaben an, bei konkreten Anlässen wie anstehenden Präsentationen oder wichtigen Verhandlungen Medikamente einzunehmen. Männer versuchen so vor allem, berufliche Ziele noch besser zu erreichen. Und sie wollen auch nach der Arbeit noch Energie für Freizeit und Privates haben. Frauen nehmen eher Medikamente, damit ihnen die Arbeit leichter von der Hand geht und sie emotional stabil genug sind. Menschen, die an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten oder bei denen Fehler schwerwiegende Konsequenzen haben können, greifen eher zu leistungssteigenden Medikamenten, zeigt die DAK-Analyse. Beschäftigte, die viel mit Kunden zu tun haben, nehmen hingegen überwiegend Tabletten zur Stimmungsverbesserung: Fast jede fünfte Frau nennt viele Kontakte mit Menschen als Grund für den Medikamentenmissbrauch. Vor allem Frauen zwischen 40 und 50 Jahren helfen nach. „Frauen nehmen eher bestimmte Mittel gegen Depressionen, um die Stimmung zu verbessern und Ängste und Nervosität abzubauen“, erläutert Rebscher die Motive. „Bei Männern sind es meist anregende Mittel. Sie wollen wach bleiben, stark und leistungsfähig sein.“
Führungskräfte dopen kaum
Entgegen der landläufigen Meinung sind es nicht primär Top-Manager oder Kreative, die sich mit Medikamenten zu Höchstleistungen pushen wollen. Die Ergebnisse des DAK-Gesundheitsreports zeigen sogar den umgekehrten Zusammengang: Je unsicherer der Arbeitsplatz und je einfacher die Arbeit selbst, desto höher ist das Risiko für Hirndoping. Eine Rolle spielt das Tätigkeitsniveau der Arbeit: Beschäftigte mit einer einfachen Tätigkeit haben zu 8,5 Prozent bereits Medikamente zur Leistungssteigerung oder Stimmungsverbesserung eingenommen. Bei Gelernten oder Qualifizierten sind es nur 6,7 Prozent. Bei den hochqualifizierten Beschäftigten waren es 5,1 Prozent.
Wunderpillen gibt es nicht
Insgesamt werden zum Hirndoping am häufigsten Medikamente gegen Angst, Nervosität und Unruhe (60,6 Prozent) sowie Medikamente gegen Depressionen (34 Prozent) eingenommen. Etwa jeder achte Doper schluckt Tabletten gegen starke Tagesmüdigkeit. 11,1 Prozent nehmen Betablocker. Mehr als jeder Zweite bekommt für die entsprechenden Medikamente ein Rezept vom Arzt. Jeder Siebte erhält Tabletten von Freunden, Bekannten oder Familienangehörigen, jeder Zwölfte bestellt sie ohne Rezept im Internet. Professor Dr. Klaus Lieb, Facharzt und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, warnt: „Der Bezug aus dem World Wide Web ist riskant. Dort gibt es viele Medikamentenfälschungen, die ohne Rezept abgegeben werden und der Gesundheit erheblich schaden können.“ Der Doping-Experte dämpft zudem Erwartungen an das pharmakologische Neuro-Enhancement: „Eine Wunderpille gibt es nicht. Oft zeigen die Medikamente nur kurzfristige und minimale Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Demgegenüber stehen hohe gesundheitliche Risiken, wie körperliche Nebenwirkungen bis hin zur Persönlichkeitsveränderung und Abhängigkeit.“ Herzrhythmusstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Nervosität und Schlafstörungen seien nicht selten – und mögliche Langzeitfolgen dagegen noch völlig unklar.
Stress aktiv angehen
Nach Ansicht von Experten ist neben dem äußeren Druck am Arbeitsplatz auch die innere Haltung entscheidend, wenn es um die Anfälligkeit für das Dopen geht. So seien übertriebene Ansprüche an die eigene Leistungsfähigkeit häufig ein Problem. Anstatt zur Pille zu greifen, sei es deshalb wichtig zu erkennen, dass Stress-Situationen am Arbeitsplatz nicht völlig vermeidbar sind. Laut DAK-Report ist der Großteil der Arbeitnehmer hier schon auf dem richtigen Weg: Demnach setzt mehr als jeder Zweite auf eine gute Organisation bei der Arbeit. 44 Prozent der Beschäftigten achten darauf, ihre Freizeit möglichst sinnvoll zu verbringen. Sechs von Zehn schlafen ausreichend, um besonders leistungsfähig zu sein.
Krankenstand sinkt leicht
Der DAK-Gesundheitsreport wertet auch die Krankenstandsdaten der Arbeitnehmer umfassend aus. 2014 lag für etwas weniger als jeden zweiten Arbeitnehmer eine Krankschreibung vor (48 Prozent, 2013: 51 Prozent). Fast ein Viertel der Ausfalltage (22,7 Prozent) wurden von Muskel-Skelett-Erkrankungen verursacht, 17 Prozent gingen zu Lasten psychischer Krankheiten und 14 Prozent entfielen auf Erkrankungen des Atmungssystems wie beispielsweise Erkältungen. Die Branchen mit dem höchsten Krankenstand waren 2014 das Gesundheitswesen, die Öffentliche Verwaltung sowie Verkehr, Lagerei und Kurierdienste mit jeweils 4,5 Prozent.
Pressestelle der DAK, 17.03.2015