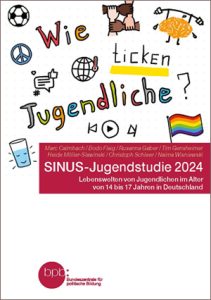 Die qualitative Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche?“ untersucht alle vier Jahre auf Basis von mehrstündigen Einzelexplorationen die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen und berichtet über die aktuelle Verfassung der jungen Generation in den unterschiedlichen Lebenswelten. Die Studie ist im Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) als Buch zu bestellen (Band-Nr. 11133, 4,50 €, http://www.bpb.de/11133 ). (Anm. d. Red.: Ein kostenfreier Download wird angeboten, funktioniert aber nicht.)
Die qualitative Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche?“ untersucht alle vier Jahre auf Basis von mehrstündigen Einzelexplorationen die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen und berichtet über die aktuelle Verfassung der jungen Generation in den unterschiedlichen Lebenswelten. Die Studie ist im Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) als Buch zu bestellen (Band-Nr. 11133, 4,50 €, http://www.bpb.de/11133 ). (Anm. d. Red.: Ein kostenfreier Download wird angeboten, funktioniert aber nicht.)
Die 14- bis 17-Jährigen sind besorgter denn je.
Die Vielzahl von Krisen und Problemen wie Kriege, Energieknappheit, Inflation oder Klimawandel, die sich mitunter überlagern und verstärken, stimmt die Jugendlichen in ihrem Allgemeinbefinden ernster und besorgter denn je. Die Sorge um Umwelt und Klima, die schon in der Vorgängerstudie 2020 als virulent beschrieben wurde, wächst in der jungen Generation weiter an. Auch die Verunsicherung durch die schwer einzuschätzende Migrationsdynamik und die dadurch angestoßene Zunahme von Rassismus und Diskriminierung ist unter den Teenagern beträchtlich. Und nicht zuletzt ist für viele Jugendliche der Übergang ins Berufs- und Erwachsenenleben aufgrund der unkalkulierbaren gesellschaftlichen Entwicklungen angstbesetzt.
Die Teenager haben ihren Optimismus und ihre Alltagszufriedenheit dennoch nicht verloren.
Wie die aktuelle Studie zeigt, ist der für die junge Generation typische Optimismus noch nicht verloren gegangen. Viele bewahren sich eine (zweck)optimistische Grundhaltung und schauen für sich persönlich positiv in die Zukunft. Viele der befragten Jugendlichen haben „Copingstrategien“ entwickelt und wirken insgesamt resilient.
Fast niemand ist unzufrieden mit dem eigenen Alltag – aber nur wenige sind enthusiastisch. Eine Rolle spielt dabei, dass die Befragten „seit sie denken können“ mit vielfältigen Krisen leben. Entsprechend wird ihr Optimismus nicht eingeschränkt durch die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es so für sie nie gab. Vielen geht es nach eigener Auskunft gut, weil ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind und sie sich sozial gut eingebunden fühlen. Die Weltsicht der jungen Generation entspricht keineswegs dem Klischee der verwöhnten Jugend, sondern ist von Realismus und Bodenhaftung geprägt. Das zeigen auch die angestrebten Lebensentwürfe.
Die „bürgerliche Normalbiografie“ ist immer noch Leitmotiv vieler Teenager.
An der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Halt und Geborgenheit und der hohen Wertschätzung von Familie hat sich nichts geändert. Dieses als „Regrounding“ bekannte Phänomen ist nach wie vor ein starker Trend. Der Aspekt des Bewahrenden und Nachhaltigen ist für viele Jugendliche sogar noch wichtiger geworden. Auch der Rückgang des einstmals jugendprägenden Hedonismus und der damit einhergehende Bedeutungsverlust jugendsubkultureller Stilisierungen hält an. Das zeigt sich auch im Streben nach der „Normalbiografie“ und in der Renaissance klassischer Tugenden. Was viele wollen, ist, einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Und wovon viele träumen, sind eine glückliche und feste Partnerschaft oder Ehe, Kinder, Haustiere, ein eigenes Haus oder eine Wohnung, ein guter Job und genug Geld für ein sorgenfreies Leben.
Die Akzeptanz von Diversität nimmt zu. Die Jugendlichen sind „aware“, aber nicht „woke“.
Im Wertespektrum der jungen Generation sind neben Sicherheit und Geborgenheit (Familie, Freunde, Treue) besonders soziale Werte wie Altruismus und Toleranz stark ausgeprägt. Auffällig ist, dass zunehmend deutlicher nicht nur die Toleranz in Bezug auf unterschiedliche Kulturen als Selbstverständlichkeit betont wird, sondern auch die Akzeptanz pluralisierter Lebensformen und Rollenbilder (Diversität). Neu gegenüber den Vorgängerstudien ist, dass die Jugendlichen besonders stark für die Gender-Gerechtigkeit sensibilisiert sind. Die meisten Befragten zeigen sich demonstrativ offen dafür, wenn (vor allem junge) Menschen ihr Geschlecht non-binär definieren. Zudem sind sich die Jugendlichen fortdauernder Geschlechterstereotype und Rollenerwartungen bewusst.
Die Sensibilität für Diskriminierung ist groß.
Die aktuellen politischen Krisen (wie Krieg oder Inflation) werden von den Jugendlichen registriert, emotional stärker treiben sie allerdings Probleme wie Klimawandel und Diskriminierung um. Gerade Diskriminierung gehört für viele zum Alltag, insbesondere in der Schule. Unabhängig von Schultyp und Herkunft haben die meisten Jugendlichen Diskriminierung schon selbst erlebt oder im unmittelbaren Umfeld beobachtet. Die Institution Schule vermag dem Problem oftmals nicht beizukommen.
Die Jugendlichen sind sehr sensibel für strukturelle Ungleichheiten. Sie beobachten und kritisieren offene oder verdeckte Diskriminierung. Demokratische Bildung und Praxis scheint in den Schulen eine untergeordnete Rolle zu spielen. Viele Jugendliche sehen Schule nicht als Ort, wo sie Mitbestimmung lernen und wirklich gehört werden. Nicht wenige der Befragten sprechen spontan die Ungleichheit der Bildungschancen an: Sie nehmen wahr, dass vor allem die soziale Lage über den Bildungserfolg mitentscheidet und sehen besonders migrantische Familien im Nachteil.
Das politische Interesse und Engagement der Jugendlichen ist limitiert.
Die Jugendlichen haben ein Bewusstsein für soziale Ungleichheit, zeigen aber kein gesteigertes Interesse an diesem Thema. Dasselbe trifft auf das Thema Politik generell zu. Eine gestiegene Politisierung der Jugendlichen im Vergleich zur letzten Erhebung 2020 ist nicht festzustellen. Eher hat Politik – trotz der allgegenwärtigen Krisen – einen geringen Stellenwert in ihrem Leben.
Das Bewusstsein für politische Themen wird vor allem durch deren mediale Präsenz beeinflusst, aber selten fühlt man sich persönlich betroffen (Ausnahme: Klimakrise, Diskriminierung). Krisen aktivieren einen Teil der Jugendlichen, wenn auch nur kurzfristig (z. B. Gespräche mit Vertrauten, Info-Recherchen) und führen kaum zu langfristigem politischem Engagement. Der andere Teil der Jugendlichen tendiert zur Verdrängung, weil er sich kognitiv oder emotional überfordert fühlt.
Hauptgründe für die Distanz zu politischen Themen und Beteiligungsformen sind die gefühlte Einflusslosigkeit und die als gering empfundene persönliche Kompetenz. Die Mehrheit der Jugendlichen befürwortet das Wahlrecht ab 16 Jahren. Einige fühlen sich aber nicht ausreichend dafür vorbereitet.
Jugendliche wollen gehört und ernstgenommen werden, aber nicht alle wollen mitgestalten.
Die Mehrzahl der Jugendlichen, quer durch alle Lebenswelten, möchte mitreden und Gehör finden – ob in der Familie, im (Sport)Verein, in der Jugendgruppe oder der religiösen Gemeinschaft. Was aber Mitbestimmung und Mitgestaltung angeht, sind die Einschätzungen kontrovers und, insbesondere hinsichtlich der angenommenen Erfolgschancen, stark lebensweltlich geprägt. Barriere Nr. 1, an der Mitsprache und Mitgestaltung der jungen Generation oft scheitern, sind „die Erwachsenen“, von denen sich viele Jugendliche nicht ernstgenommen und respektiert fühlen.
Awareness für Fake News und die negativen Folgen des Social Media-Konsums
Ein Leben ohne Social Media (insbesondere TikTok, Instagram und YouTube) ist für die meisten Jugendlichen nur schwer vorstellbar. Soziale Medien werden zum Zeitvertreib, zur Inspiration für Lifestyle-Themen und zum Socializing genutzt – aber auch als Tool, um Themen und Dinge, die Sinn im Leben geben, (besser) kennenzulernen und zu verfolgen.
Soziale Medien sind für die meisten Teenager die bei weitem wichtigste Informationsquelle. Dies gilt auch für politische Nachrichten, die meist zufällig – sozusagen als „Beifang“ – rezipiert werden. Vorteile der Informationsaufbereitung in den sozialen Medien sind aus Sicht der Jugendlichen ihre Aktualität, ihre gute Verständlichkeit (Prägnanz) und ihr Unterhaltungswert. Dagegen stehen die Nachteile zweifelhafter Glaubwürdigkeit und die verbreiteten Fake News.
Die Gefahr, Falschinformationen, Übertreibungen und manipuliertem Content ausgesetzt zu sein oder sich in Filterblasen zu bewegen, ist den befragten Jugendlichen bewusst. Die meisten gehen davon aus, Fake News zu erkennen, vor allem mittels „gesundem Menschenverstand“. Sind Jugendliche mit Fake News konfrontiert, werden diese meist ignoriert. Aktive Recherchen zur Glaubwürdigkeit oder Richtigkeit von Beiträgen, Nachrichten oder Meldungen kommen eher selten vor.
Die Auswirkungen des Social Media-Konsums auf das eigene Befinden und die (psychische) Gesundheit sehen viele der befragten Jugendlichen durchaus kritisch. Viele haben das Gefühl, zu viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen, was ihnen – wie sie glauben – nicht guttut: „verplemperte Lebenszeit“, Reizüberflutung, Suchtverhalten und Stress auch durch den Vergleich geschönter Darstellungen im Internet mit der eigenen (körperlichen und sozialen) Realität.
Auch wenn vieles in den sozialen Medien nicht hinterfragt bzw. unkritisch konsumiert wird, zeigt sich in der jugendlichen Zielgruppe ein wachsendes Unbehagen. Viele (v. a. bildungsnahe) Jugendliche versuchen inzwischen, ihre Social Media-Nutzung zu begrenzen bzw. aktiv zu steuern: Handy ausschalten, bestimmte Apps löschen, problematische Aspekte mit Nahestehenden besprechen.
Trotz des DigitalPakts Schule bleibt die Digitalisierung von Schulen uneinheitlich und wird von vielen Jugendlichen als unzureichend empfunden. Jugendliche wünschen sich oft mehr Engagement von Lehrkräften, wenn es um die Integration digitaler Elemente im Unterricht geht. Oftmals haben sie das Gefühl, die Lehrkräfte seien gegenüber digitalen Möglichkeiten nicht genug aufgeschlossen.
Sport als „Droge gegen Stress“
Auch Sport und Bewegung dienen Jugendlichen, um dem Alltagsstress entgegenzuwirken und Probleme zu vergessen. Auf die Nachfrage, welche Rolle Sport und Bewegung für das eigene Wohlbefinden spielt, berichten die meisten – unabhängig von Geschlecht, Bildung und Lebenswelt – von einem „guten Gefühl“, das sich sowohl während als auch nach dem Sport einstellt. Zudem steht das Motiv der Vergemeinschaftung im Fokus: Sport- und Bewegungsstätten sind für Jugendliche wichtige Orte der Begegnung und des Zusammenkommens. Aber: Viele beklagen, dass es ihnen an öffentlichen Bewegungsorten fehlt.
Studiendesign
Die vorliegende Studie ist eine qualitativ-empirische Bestandsaufnahme der soziokulturellen Verfassung der jungen Generation. Unterschiedlichste Aspekte der jugendlichen Alltags- und Lebenswirklichkeit (Schule, Gesundheit, Sport, Politik etc.) werden in der Publikation nicht nur beschrieben, sondern mittels einer Vielzahl persönlicher Zeugnisse der Jugendlichen illustriert. Wie in den Vorgängerstudien greift das SINUS-Institut hierbei auf ein breites methodisches Spektrum zurück: Neben den Analysen der explorativen Interviews enthält der Forschungsbericht zahlreiche Bilddokumente wie Skizzen, Fotos und Collagen sowie eine Vielzahl von O-Tönen der befragten Jugendlichen, die authentische Einblicke quer durch alle jungen Lebenswelten liefern.
Insgesamt wurden 72 qualitative Fallstudien mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte deutschlandweit von Anfang Juni bis Ende September 2023. „Wie ticken Jugendliche?“ wurde im Auftrag folgender Studienpartner (in alphabetischer Reihenfolge) durchgeführt:
- Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz
- Bund der Deutschen Katholischen Jugend
- Bundeszentrale für politische Bildung
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
- DFL Stiftung
Pressestelle der Bundeszentrale für politische Bildung, 12.6.2024

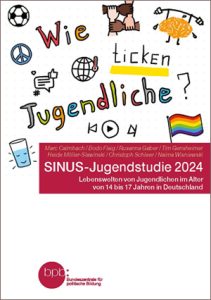 Die qualitative Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche?“ untersucht alle vier Jahre auf Basis von mehrstündigen Einzelexplorationen die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen und berichtet über die aktuelle Verfassung der jungen Generation in den unterschiedlichen Lebenswelten. Die Studie ist im Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) als Buch zu bestellen (Band-Nr. 11133, 4,50 €,
Die qualitative Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche?“ untersucht alle vier Jahre auf Basis von mehrstündigen Einzelexplorationen die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen und berichtet über die aktuelle Verfassung der jungen Generation in den unterschiedlichen Lebenswelten. Die Studie ist im Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) als Buch zu bestellen (Band-Nr. 11133, 4,50 €, 

