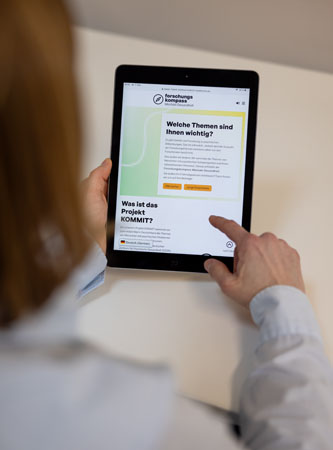Der Bundestag hat am 23. Februar 2024 in abschließender Lesung die kontrollierte Weitergabe von Cannabis zu Konsumzwecken beschlossen. Damit wird der private Eigenanbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen zum Eigenkonsum sowie der gemeinschaftliche, nicht-gewerbliche Eigenanbau zum Eigenkonsum in Anbauvereinigungen bzw. Genossenschaften für Erwachsene erlaubt. Gleichzeitig werden mit dem Gesetz der Gesundheitsschutz, der Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Prävention und Aufklärung gestärkt.
Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum bleibt straffrei. Gleichzeitig gilt für Cannabis als auch Anbauvereinigungen ein allgemeines Werbe- und Sponsoringverbot.
So werden Kinder und Jugendliche geschützt
Verboten ist der Konsum von Cannabis:
- in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen
- in/auf und in Sichtweite (100 Meter) von Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und öffentlich zugänglichen Sportstätten
- in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr
- in Anbauvereinigungen und in Sichtweite von Anbauvereinigungen (100 Meter)
- Anbauvereinigungen dürfen Konsumcannabis ausschließlich an Mitglieder, verbunden mit einer strikten Pflicht zur Überprüfung der Mitgliedschaft und des Alters, weitergeben (max. 25 Gramm pro Tag / 50 Gramm pro Monat; an Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren max. 30 Gramm pro Monat mit max. 10 Prozent THC-Gehalt). Die Mindestmitgliedschaftsdauer in einer Anbauvereinigung beträgt drei Monate.
- Der in begrenztem Umfang zulässige private Eigenanbau muss vor dem Zugriff durch Kinder, Jugendliche sowie Dritte geschützt werden.
- Für die vorsätzliche gewerbliche Abgabe oder die Überlassung von Cannabis und anderen Betäubungsmitteln an Kinder und Jugendliche gelten nunmehr höhere Strafen als ursprünglich vorgesehen. Mindeststrafrahmen: zwei Jahre Freiheitsstrafe (vormals ein Jahr). Ebenfalls eine Mindeststrafe von zwei Jahren gilt für den bandenmäßigen Anbau, die bandenmäßige Herstellung, Einfuhr oder Ausfuhr, das bandenmäßige Handeltreiben von Cannabis in nicht geringen Mengen.
- Die Auswirkungen des Gesetzes auf den Kinder- und Jugendschutz werden wissenschaftlich evaluiert. 18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt eine erste Evaluation der Auswirkungen des Konsumverbots auf den Kinder- und Jugendschutz im ersten Jahr. Zwei Jahre nach Inkrafttreten wird ein Zwischenbericht zu Auswirkungen des Gesetzes, einschließlich der Auswirkungen auf die cannabisbezogene organisierte Kriminalität unter Einbeziehung der Expertise des Bundeskriminalamtes, vorgelegt. Vier Jahre nach Inkrafttreten erfolgt eine umfassende und abschließende Evaluation des Gesetzes.
- Die Präventionsangebote der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden ausgebaut.
Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität
- Der gemeinschaftliche Eigenanbau in einer Anbauvereinigung ist erlaubnispflichtig. Die Vereinigungen müssen bei der zuständigen Erlaubnisbehörde vor Ort umfangreiche Angaben zu Anbauflächen, Beschäftigten und Vorstandsmitgliedern machen. Insbesondere bei einschlägigen Vorstrafen (z. B. Geldwäsche, Betrug) wird keine Erlaubnis erteilt.
- Die Überwachungsbehörden können vor Ort die Einhaltung der Vorgaben des Gesundheits- und Jugendschutzes kontrollieren, Proben nehmen sowie einer Anbauvereinigung Auflagen erteilen und bei Verstößen die Erlaubnis entziehen.
- Die Anbauvereinigungen dürfen nicht gewinnbringend tätig sein, also lediglich Mitgliedsbeiträge verlangen. Der gewerbliche Umgang mit Cannabis bleibt verboten.
- Verboten bleibt ebenfalls Import, Export und Durchfuhr von Cannabis sowie Versand, Lieferung und Onlinehandel.
Verbesserungen bei Medizinalcannabis
- Medizinalcannabis bleibt weiterhin in pharmazeutischer Qualität für Patientinnen und Patienten durch inländischen Anbau und Importe verfügbar und wird künftig in einem eigenen Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) geregelt.
- Das Vergabeverfahren für den Anbau von Medizinalcannabis wird abgeschafft und durch ein reines Erlaubnisverfahren ersetzt. Durch die Abschaffung werden Hürden für den marktgerechten Anbau in Deutschland verringert und Chancengleichheit für die deutschen Anbauer im internationalen Wettbewerb hergestellt. Durch das Erlaubnisverfahren und Inspektionen wird weiter gewährleistet, dass Medizinalcannabis ein sicheres und kontrolliertes Arzneimittel bleibt.
Mehr Schutz von Jugendlichen vor Betäubungsmittelmissbrauch
- Jugendliche sollen zukünftig besser vor Betäubungsmitteln, wie z. B. Crack und Heroin, geschützt werden.
- Dazu sind im Cannabisgesetz auch zusätzliche Strafschärfungen im Betäubungsmittelrecht vorgesehen: Der Mindeststrafrahmen für Abgabe, Verabreichen oder Überlassen von Betäubungsmittel durch über 21-Jährige an Minderjährige wird von einem Jahr auf zwei Jahre angehoben, wenn die Täterin/der Täter dabei vorsätzlich handelt und dadurch wenigstens leichtfertig ein Kind oder eine jugendliche Person in der körperlichen, geistigen oder sittlichen Entwicklung schwer gefährdet.
Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.
Der Bundesrat wird das Cannabisgesetz am 22. März 2024 beraten. Das Cannabisgesetz soll am 1. April 2024 in Kraft treten. Das Inkrafttreten der Regelungen zu Anbauvereinigungen und zum gemeinschaftlichen Eigenanbau in Anbauvereinigungen ist in einer zweiten Stufe für den 1. Juli 2024 vorgesehen.
Hintergrund
4,5 Millionen Erwachsene haben nach einer Erhebung im Jahr 2021 in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Cannabis konsumiert (10,7 Prozent der Männer sowie 6,8 Prozent der Frauen – 12-Monatsprävalenz). Am häufigsten wurde Cannabis in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen konsumiert (bezogen auf die 12-Monatsprävalenz).
Pressestelle des Bundesministeriums für Gesundheit, 23.2.2024

 Um auch die Perspektive der Konsumierenden (ab 16 Jahren) einzubeziehen, bittet das NEWS-Team Sie auch, den folgenden Link zu einer Online-Befragung für Konsumierende in Ihrem Netzwerk zu teilen:
Um auch die Perspektive der Konsumierenden (ab 16 Jahren) einzubeziehen, bittet das NEWS-Team Sie auch, den folgenden Link zu einer Online-Befragung für Konsumierende in Ihrem Netzwerk zu teilen: