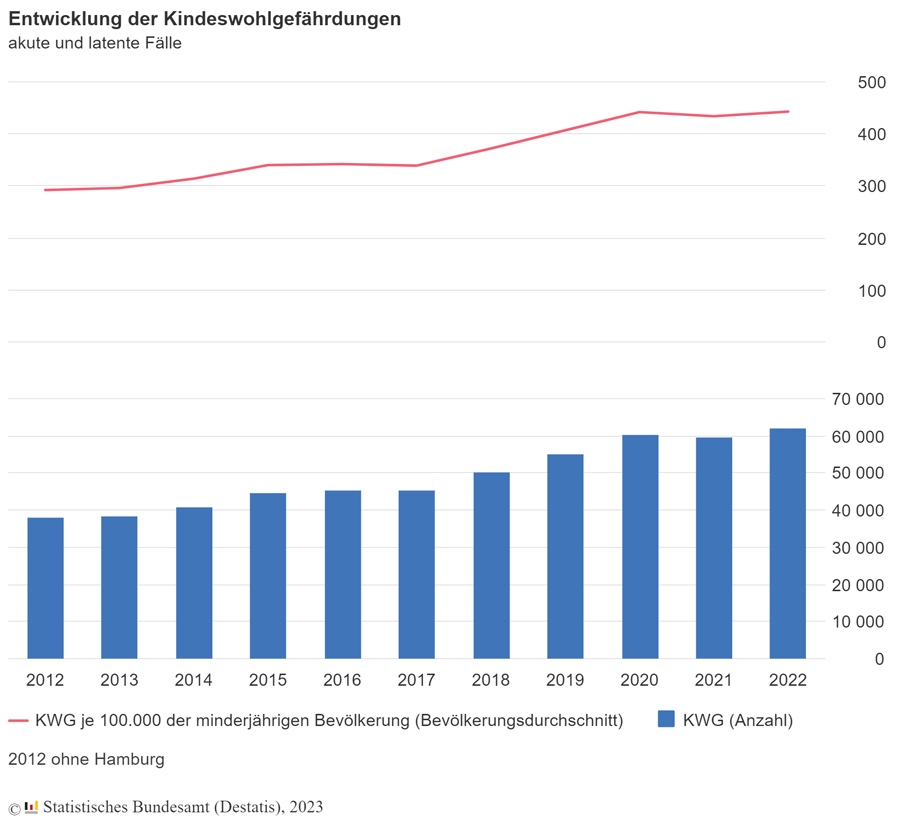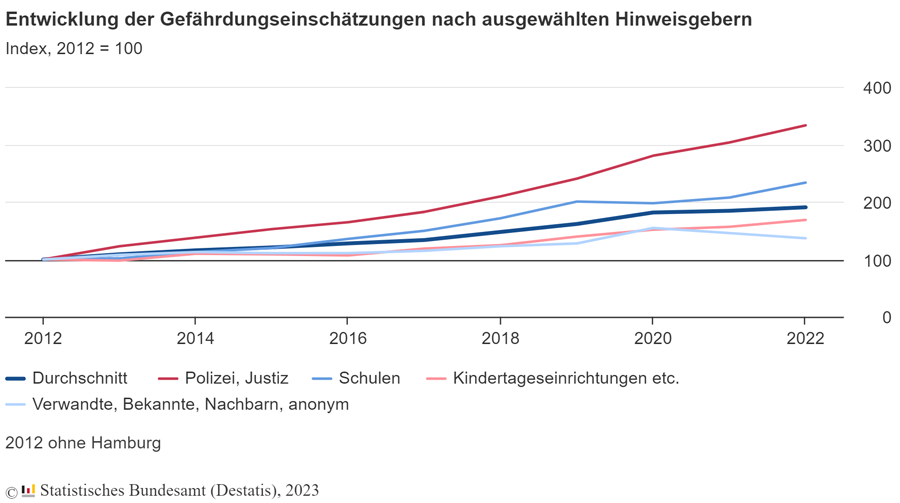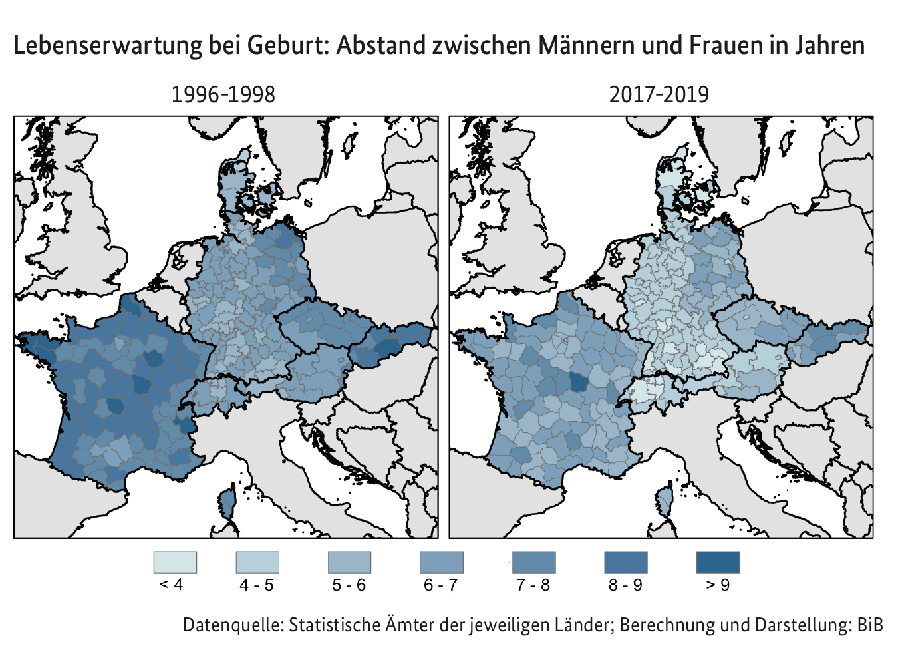Die Zahl der Opfer von Häuslicher Gewalt lag im Jahr 2022 bei 240.547 und ist damit um 8,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen. Das zeigt das neue umfassende Lagebild, das am 11.7.2023 von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesfrauenministerin Lisa Paus und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in Berlin vorgestellt wurde.
Die Zahl der Opfer von Häuslicher Gewalt lag im Jahr 2022 bei 240.547 und ist damit um 8,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen. Das zeigt das neue umfassende Lagebild, das am 11.7.2023 von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesfrauenministerin Lisa Paus und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in Berlin vorgestellt wurde.
Bundesfrauenministerin Lisa Paus: „Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von Häuslicher Gewalt. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Expartner eine Frau zu töten. Die deutlich gestiegenen Zahlen zeigen die traurige Realität: Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches und alltägliches Problem. Sie wird ausgeübt, um Macht über Frauen aufrechtzuerhalten. Ich setze mich dafür ein, die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen zu schließen. Ich bin sehr froh, dass wir trotz schwieriger Haushaltslage die Finanzierung von Baumaßnahmen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen in diesem und kommenden Jahr um zusätzliche zehn Millionen Euro stärken können und im kommenden Jahr auf dem Niveau von 30 Millionen Euro fortschreiben.“
 Das neue Lagebild Häusliche Gewalt ist eine Fortschreibung und Ergänzung der früheren Kriminalstatistischen Auswertung Partnerschaftsgewalt, die seit 2015 jährlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht wurde. Neben der Partnerschaftsgewalt werden nun auch die Delikte der sog. innerfamiliären Gewalt von und gegen Eltern, Kinder, Geschwister und sonstige Angehörige mitbetrachtet, so dass es nun eine bundesweite Lageübersicht zur Häuslichen Gewalt insgesamt gibt.
Das neue Lagebild Häusliche Gewalt ist eine Fortschreibung und Ergänzung der früheren Kriminalstatistischen Auswertung Partnerschaftsgewalt, die seit 2015 jährlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht wurde. Neben der Partnerschaftsgewalt werden nun auch die Delikte der sog. innerfamiliären Gewalt von und gegen Eltern, Kinder, Geschwister und sonstige Angehörige mitbetrachtet, so dass es nun eine bundesweite Lageübersicht zur Häuslichen Gewalt insgesamt gibt.
Im Bereich der Partnerschaftsgewalt stieg die Anzahl der Opfer um 9,1 Prozent auf 157.818 Opfer. Ganz überwiegend trifft Gewalt im häuslichen Kontext Frauen: 80,1 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt und 71,1 Prozent der Opfer Häuslicher Gewalt insgesamt sind weiblich. Von den Tatverdächtigen bei Partnerschaftsgewalt sind 78,3 Prozent Männer, im Gesamtbereich der Häuslichen Gewalt 76,3 Prozent.
Im Bereich der Partnerschaftsgewalt lebte die Hälfte der Opfer mit der tatverdächtigen Person zusammen. Die Mehrheit sowohl der Opfer als auch der Tatverdächtigten waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, im Bereich der Innerfamiliären Gewalt waren unter 21-Jährige am häufigsten betroffen. 133 Frauen und 19 Männer sind im Jahr 2022 durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet worden.
Opfer von Häuslicher Gewalt im Jahr 2022
Folgende Liste zeigt die Anzahl der Opfer von Häuslicher Gewalt im Jahr 2022 nach Delikten (jeweils vollendete und versuchte Delikte):
- Opfer von Tötungsdelikten: 702 Opfer (248 männlich und 454 weiblich), davon 239 Opfer von vollendeten Tötungsdelikten (58 männlich und 181 weiblich) und 463 Opfer von versuchten Tötungsdelikten (190 männlich, 273 weiblich)
- Opfer von vorsätzlicher einfacher Körperverletzung: 135.502 Opfer (39.766 männlich und 95.736 weiblich)
- Opfer von Bedrohung, Stalking und Nötigung: 57.376 Opfer (13.332 männlich und 44.044 weiblich)
- Opfer von Freiheitsberaubung: 2.575 Opfer (437 männlich und 2.138 weiblich)
- Opfer von gefährlicher Körperverletzung: 28.589 Opfer (11.277 männlich und 17.312 weiblich)
Die Zahlen von polizeilich registrierter Häuslicher Gewalt steigen nahezu kontinuierlich an, in den letzten fünf Jahren um 13 Prozent. Doch viele Taten werden der Polizei nicht gemeldet, etwa aus Angst oder Scham.
Start einer umfassenden Dunkelfeldstudie
Wie groß dieses Dunkelfeld ist, soll die Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) herausfinden. Die großangelegte Untersuchung wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie dem Bundeskriminalamt verantwortet. Deutschlandweit sollen 22.000 Menschen befragt werden. Erste Ergebnisse werden 2025 vorliegen.
Die Teilnehmenden an der Studie werden zufällig aus den Einwohnermelderegistern ausgewählt. Befragt werden sie zur aktuellen Lebenssituation, zu Sicherheit und zu Belastungen im Alltag. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erhebung von Gewalterfahrungen in Paarbeziehungen sowie Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und digitaler Gewalt. Zudem enthält die Studie Fragen zu Erfahrungen mit Polizei, Medizin, Gerichten und Opferhilfeeinrichtungen.
Zwanzig Jahre nach der letzten Opferbefragung des BMFSFJ liefert die Studie nicht nur aktuelle, repräsentative, bundesweite Daten zur Gewaltbelastung von Frauen, sondern erstmals auch von Männern. Mit der Durchführung von Zusatzstichproben werden zudem repräsentative Aussagen zur Gewaltbelastung in Partnerschaften, sexualisierter und digitaler Gewalt von Menschen mit Migrationshintergrund ermöglicht.
Für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts wurde ein Forschungsbeirat einberufen, dem zehn Expertinnen und Experten aus den Bereichen Gewalt-, Gender- und Umfrageforschung sowie Opferhilfe und Medizin angehören.
Das Lagebild Häusliche Gewalt zum Berichtjahr 2022 finden Sie hier: www.bmi.bund.de/20336752
Weitere Informationen zur Studie unter: www.bka.de/lesubia
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet Frauen unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose und anonyme Beratung in 18 Sprachen an. Weitere Informationen unter www.hilfetelefon.de
Pressemitteilung des Bundesfamilienministeriums,11.7.2023