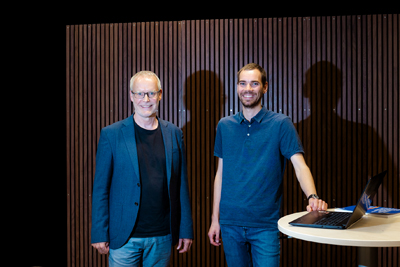Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Familien brauchen professionelle Unterstützung. Um Betroffene frühzeitig zu erkennen und in adäquate Hilfsangebote vermitteln zu können, ist die Zusammenarbeit von Akteuren aus Kita, Schule, Jugendamt, Gesundheitsversorgung und angrenzenden Handlungsfeldern unerlässlich. Fachkräfte müssen nicht nur für den Umgang mit dem Thema sensibilisiert und qualifiziert sein, sondern auch gemeinsam und im Austausch mit anderen Fachbereichen und Professionen an passgenauen Lösungen für die Kinder und Jugendlichen arbeiten. Das Präventionsprojekt „selbstbestimmt“ der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. setzt an dieser Stelle an und plant mit Förderung des GKV-Bündnisses für Gesundheit, der Auridis Stiftung und dem Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg bedarfsgerechte Qualifizierungs- und Kommunikationsmaßnahmen sowie die Entwicklung Kommunaler Gesamtkonzepte in drei Modellregionen Brandenburgs.
Zwei neue Teilprojekte von „selbstbestimmt“ wurden am 13. August in Potsdam erstmals vorgestellt:
- Kommunale Gesamtkonzepte: In drei Pilotkommunen sollen modellhaft kommunale Gesamtkonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Ziel ist es, durch die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Hilfesysteme tragfähige Strukturen zu schaffen, die langfristig wirken und auf weitere Kommunen übertragbar sind. Das Teilprojekt wird durch die von ALDI SÜD finanzierte Auridis Stiftung mit rund 750.000 Euro bis Ende 2028 gefördert.
- Qualifizierung und Kommunikation: Dieser Projektbereich wird, gefördert durch das GKV-Bündnis für Gesundheit und das Gesundheitsministerium, mit neuen Impulsen fortgeführt. Er stärkt Fachkräfte im Umgang mit betroffenen Kindern, fördert die Zusammenarbeit zentraler Akteure und trägt dazu bei, das Thema Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Familien stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Das Teilprojekt wird vom GKV-Bündnis für Gesundheit bis Mai 2029 mit insgesamt rund 1,7 Millionen Euro gefördert.
Das Gesundheitsministerium finanziert die Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V. mit rund 400.000 Euro pro Jahr aus Landesmitteln, davon stehen rund 100.000 Euro für die Landeskoordinierung Suchtprävention zur Verfügung.
Informationen zum Projekt: https://www.selbstbestimmt-brandenburg.de/
Hintergrund
Etwa jedes sechste Kind lebt in einem suchtbelasteten Haushalt. Deutschlandweit sind es Schätzungen zufolge zwischen drei bis sechs Millionen Minderjährige, die in einer sucht- oder psychisch belasteten Familie aufwachsen. Viele der eigentlich gesunden Kinder entwickeln durch die Belastungssituation in ihren Familien im Lauf ihres Lebens ebenfalls eine Sucht oder eine andere psychische Erkrankung. Für viele gehören Vernachlässigung, Überforderung, aber auch Scham und Hilflosigkeit zum Alltag.
Um dem entgegenzuwirken, beschäftigt sich bereits seit Anfang 2021 das „selbstbestimmt“-Team der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen mit dem Thema Suchtprävention für vulnerable Zielgruppen im Land Brandenburg – mit Unterstützung des GKV-Bündnisses für Gesundheit und dem Gesundheitsministerium. Aufgrund der großen Resonanz fiel gemeinsam mit den Förderern der Entschluss, das Projekt ab Mitte 2025 bis Ende 2028 mit dem Fokus auf Qualifizierung und Kommunikation fortzuführen.
Den großen Handlungsbedarf im Themenfeld zeigt nicht zuletzt eine Bedarfserhebung des Projekts im Frühjahr 2025: Gut 55 Prozent der 249 befragten Fachkräfte hatten oft bis sehr oft in ihrem Alltag mit Kindern aus sucht- und psychisch belasteten Familien zu tun. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden gab jedoch an, kein Hilfsangebot im Themenfeld zu kennen. Bei der Frage danach, was die Fachkräfte für eine bessere Versorgung Betroffener bräuchten, äußerten sie vorrangig den Wunsch nach Vernetzung, mehr zeitlichen und personellen Ressourcen sowie weiteren Hilfsangeboten.
Damit entsprechende Maßnahmen für eine bessere Versorgung nachhaltig und effektiv implementiert werden können, ergänzt für die zweite Projektlaufzeit der Baustein Kommunale Gesamtkonzepte für Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Familien die selbstbestimmt-Aktivitäten. In dem von der Auridis Stiftung geförderten Teilprojekt sollen der Aufbau wirksamer Vernetzungsstrukturen und die Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote vor Ort in drei strukturell unterschiedlichen Modellkommunen begleitet und anschließend auf weitere Kommunen im Land Brandenburg übertragen werden.
Pressestelle der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V., 13.8.2025