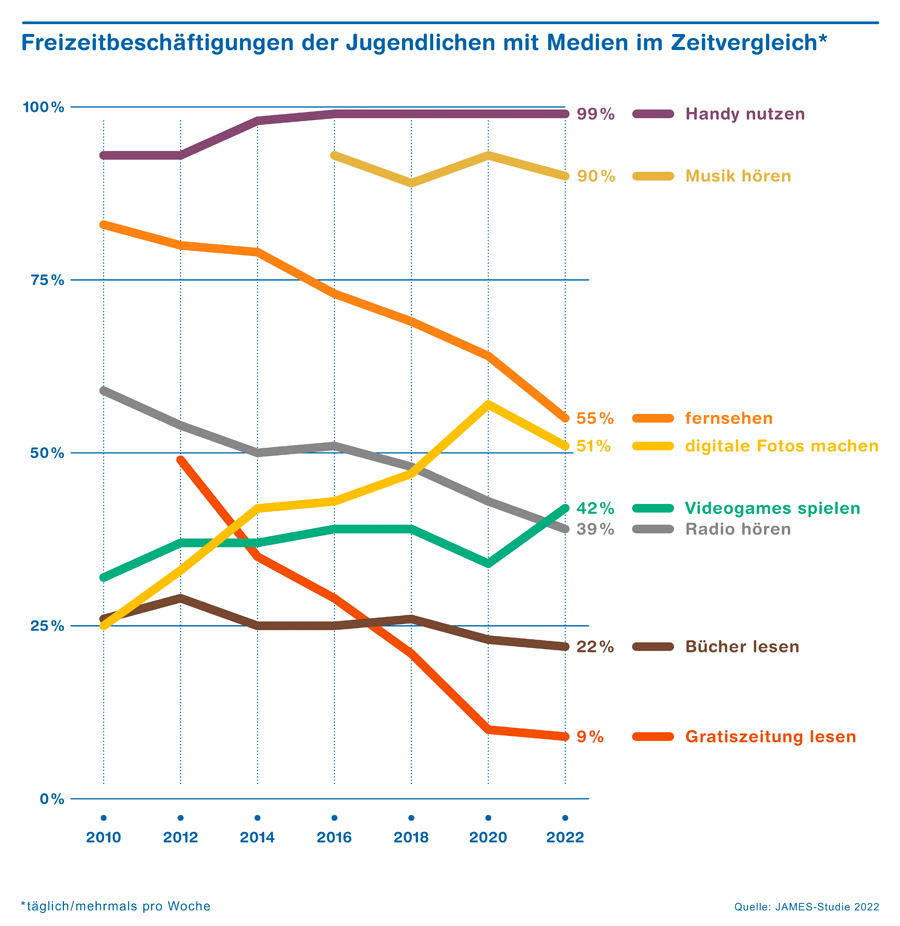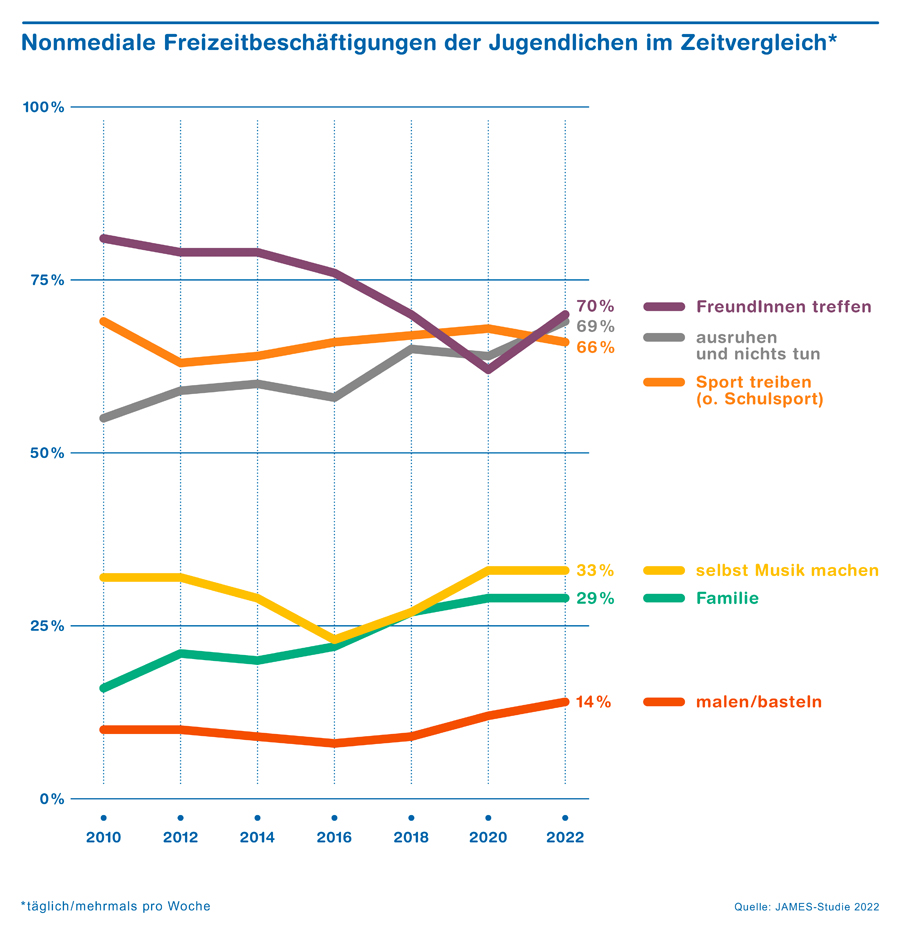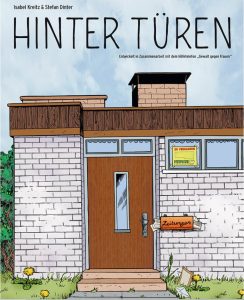Im Auftrag des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Federführung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) die Frage untersucht, welche Maßnahmen einer sozialen Isolation und Einsamkeit im Alter vorbeugen oder entgegenwirken könnten. Ihr Fazit: Die große Uneinheitlichkeit und methodische Schwächen der vorliegenden Studien lassen keine eindeutigen Aussagen zu der Frage zu, welche Maßnahmen helfen. Für einige Ansätze deuten sich aber positive Effekte an.
Anfrage eines Bürgers war Ausgangspunkt des ThemenCheck-Berichts
Etwa zehn Prozent der Erwachsenen berichten, dass sie sich oft einsam fühlen. Einsamkeit kann, insbesondere wenn sie auf Dauer besteht, ein Risikofaktor für schlechte Gesundheit und geringe Lebensqualität sein. Deshalb hat sich auch die Bundesregierung des Themas angenommen und angekündigt, bis zum Ende der Legislaturperiode eine Strategie gegen Einsamkeit vor allem bei älteren Menschen zu erarbeiten. Zwar fühlen sich ältere Menschen nicht häufiger einsam als jüngere, sie sind aber öfter Veränderungen ausgesetzt, die soziale Isolation und belastende Gefühle von Einsamkeit begünstigen, wie etwa eine knappe Rente, der Verlust beruflicher Kontakte mit dem Eintritt ins Rentenalter, der Wegzug von Angehörigen, Krankheiten, eingeschränkte Mobilität sowie abnehmendes Hör- und Sehvermögen.
Ältere Menschen, die sozial isoliert oder einsam sind, leiden häufiger unter Bluthochdruck, Angststörungen, Depressionen und Schlafstörungen. Zudem sterben sie oft früher als sozial eingebundene Menschen. Vor diesem Hintergrund stellte ein Bürger im Rahmen des ThemenChecks Medizin die Frage, ob es wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung und Reduzierung sozialer Isolation im Alter gibt.
Bei vier Maßnahmen positive Ergebnisse
Das beauftragte Wissenschaftsteam unter der Federführung des UKE konnte insgesamt 14 Studien zur Fragestellung identifizieren, davon sechs zur Prävention bei Menschen, die ein erhöhtes Risiko für soziale Isolation hatten, und acht zur Therapie bei Menschen, die bereits sozial isoliert waren. Diese Studien untersuchten unterschiedliche Angebote: Besuche oder Telefonate mit Ehrenamtlichen, Sportkurse, Freizeitangebote, eine Tablet-Schulung, psychotherapeutische Unterstützung und die Begleitung durch Gesundheitslotsen. Allerdings haben die vorliegenden Studien Schwächen und sind nicht sehr aussagekräftig, sodass sich schlecht beurteilen lässt, wie hilfreich die untersuchten Angebote sind. Vier Studien deuten aber positive Effekte an – davon drei zur Therapie und eine zur Prävention:
In den USA zeigte ein Programm, dass persönliche oder telefonische Kontakte mit gleichaltrigen ehrenamtlichen Personen Angstsymptome bei älteren Menschen von durchschnittlich 71 Jahren reduzieren konnten. Das Programm lief über ein Jahr, die Kontakte erfolgten einmal pro Woche.
In Kanada zeigte ein Programm, dass Besuche durch ehrenamtlich tätige Studierende die Lebenszufriedenheit steigern konnten. Die Studierenden besuchten die älteren Menschen, die im Durchschnitt ca. 79 Jahre alt waren, sechs Wochen lang einmal pro Woche für drei Stunden. Sie unternahmen beispielsweise Spaziergänge, lasen vor oder unterstützten im Haushalt.
In Finnland wurde ein dreimonatiges Programm erprobt, in dem die Teilnehmenden im Alter von durchschnittlich 80 Jahren zwischen verschiedenen Angeboten wählen konnten: therapeutisches Schreiben und Psychotherapie, Sport und Diskussion von Gesundheitsthemen oder Beschäftigung mit Kunst, Musik, Theater und Malerei. Die Angebote fanden in Gruppen statt und wurden professionell betreut. Die Teilnehmenden des Programms fühlten sich gesünder, und es gab innerhalb von zwei Jahren nach dem Programm sogar weniger Sterbefälle als bei Personen, die das Programm nicht erhalten hatten.
In China wurde ein Präventions-Programm für ältere Menschen entwickelt, deren erwachsene Kinder aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen waren. In von Fachleuten geführten Gruppentreffen sollte das Interesse an sozialer Interaktion gesteigert und gegenseitige Hilfe gefördert werden. Das Programm dauerte sieben Monate und konnte die soziale Unterstützung der Teilnehmenden steigern.
Ob die Maßnahmen weitere Vorteile haben, bleibt unklar. Zudem wurde in keiner der Studien untersucht, ob die Maßnahmen auch negative Auswirkungen hatten.
Der ThemenCheck Medizin
Interessierte Einzelpersonen können im Rahmen des ThemenChecks Medizin Vorschläge für die Bewertung von medizinischen Verfahren und Technologien einreichen. In einem zweistufigen Auswahlverfahren, an dem auch Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind, werden aus allen eingereichten Vorschlägen jedes Jahr bis zu fünf neue Themen ausgewählt. Laut gesetzlichem Auftrag sollen dies Themen sein, die für die Versorgung von Patientinnen und Patienten von besonderer Bedeutung sind.
Die ThemenCheck-Berichte werden nicht vom IQWiG selbst verfasst, sondern von externen Sachverständigen. Deren Bewertung wird gemeinsam mit einer allgemein verständlichen Kurzfassung und einem IQWiG-Herausgeberkommentar veröffentlicht.
Originalpublikation auf der Website des IQWiG:
Soziale Isolation und Einsamkeit im Alter: Welche Maßnahmen können einer sozialen Isolation vorbeugen oder entgegenwirken?
Pressestelle des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), 30.11.2022
Literaturtipp
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Einsamkeit liefert jetzt die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift „PiD – Psychotherapie im Dialog“ (Ausgabe 4/2022, Georg Thieme Verlag). Expert:innen aus Psychotherapie und Medizin berichten über Risikofaktoren, seelische und körperliche Folgen von Einsamkeit sowie ihre Ausprägung in unterschiedlichen Lebensphasen und -situationen: von der Kindheit bis zum Alter, bei pflegenden Angehörigen oder bei einer vorliegenden Depression. (Anm. d. Red. KONTUREN)