Die Ergebnisse des größten europäischen Projekts im Bereich Abwasseranalyse „Abwasseranalyse und Drogen – eine europäische städteübergreifende Studie“ liegen jetzt für das Jahr 2021 vor. Die Studie wird von der europaweiten SCORE-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) veröffentlicht. Im Rahmen des Projekts wurden Abwasser in 75 europäischen Städten aus 25 Ländern (23 EU, Türkei und Norwegen) analysiert, um Aufschluss über das Drogenverhalten ihrer Einwohner zu gewinnen. Dies ist die höchste Zahl von Ländern, die bislang teilgenommen haben, trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie im betreffenden Studienzeitraum. Die SCORE-Gruppe führt seit 2011 jährliche Studien zur Abwasserüberwachung durch. Damals nahmen erst 19 Städte aus zehn Ländern teil.
Von Barcelona bis Limassol und von Oslo bis Porto wurden im Rahmen der Studie täglich Abwasserproben in den Einzugsgebieten von Klärwerken über einen Zeitraum von einer Woche zwischen März und Mai 2021 analysiert. Das Abwasser von etwa 45 Millionen Menschen wurde auf Spuren von vier illegalen Stimulanzien (Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, MDMA/Ecstasy) sowie Cannabis untersucht.
Die aktuelle Studie weist auf einen Anstieg bei vier der fünf untersuchten Drogen hin. MDMA war die einzige Droge, bei der in den meisten untersuchten Städten ein Rückgang zu verzeichnen war. Bemerkenswert in dieser jüngsten Datenerhebungsrunde ist, dass die Drogen gleichmäßig an allen Studienorten gemeldet wurden, wobei alle fünf Substanzen in fast allen teilnehmenden Städten gefunden wurden. Dies ist ein Unterschied zu den Vorjahren, in denen vielfältigere geografische Muster beobachtet wurden. Die jüngsten Daten zeigen, dass Kokain zwar nach wie vor in west- und südeuropäischen Städten am stärksten verbreitet ist, jedoch zunehmend auch in osteuropäischen Städten vorkommt. Auch Methamphetamin, das ursprünglich auf Tschechien und die Slowakei konzentriert war, findet sich jetzt in Städten in ganz Europa.
Alexis Goosdeel, Direktor der EMCDDAt: „Die Ergebnisse zeigen sowohl einen Anstieg als auch eine Ausbreitung der meisten untersuchten Substanzen, was auf ein weit verbreitetes und komplexes Drogenproblem zurückzuführen ist. In den letzten zehn Jahren hat sich die Abwasseranalyse von einer experimentellen Technik zu einem bewährten Instrument zur Überwachung des illegalen Drogenkonsums in Europa entwickelt. In dieser jüngsten Studie zeichnet sich das künftige Potenzial der Abwasserforschung ab, das von der Identifizierung neuer psychoaktiver Substanzen und der Evaluierung von Maßnahmen bis hin zu Programmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Verbesserung der Vorsorge und Maßnahmen reicht.“
Wichtigste Ergebnisse 2021
Kokain: Kokainrückstände im Abwasser waren in west- und südeuropäischen Städten nach wie vor am höchsten (insbesondere in Belgien, den Niederlanden und Spanien), aber auch in den meisten osteuropäischen Städten wurden Spuren gefunden, bei denen sich ein Anstieg zeigte. Im Jahr 2021 verzeichnete mehr als die Hälfte der Städte einen Anstieg der Kokainrückstände im Vergleich zu den Daten für 2020 (32 der 58 Städte, aus denen Daten für beide Jahre vorliegen). Im Rahmen des kürzlich durchgeführten europäischen Abwasserprojekts EUSEME wurden auch Crack-Rückstände in allen der 13 beteiligten europäischen Städte gefunden, die höchsten Belastungen traten in Amsterdam und Antwerpen auf.
Methamphetamin
Diese Droge ist traditionell auf Tschechien und die Slowakei konzentriert und wird nun in Belgien, Zypern, Ostdeutschland, Spanien, der Türkei und mehreren nordeuropäischen Ländern (z. B. Dänemark, Litauen, Finnland und Norwegen) nachgewiesen. Von den 58 Städten, aus denen Daten für 2021 und 2020 vorliegen, meldete etwa die Hälfte (27) einen Anstieg der Rückstände. (Im Gegensatz zu den anderen drei Stimulanzien waren die Rückstände an den meisten Orten sehr gering bis vernachlässigbar).
Amphetamin
Bei den Amphetaminrückständen unterschieden sich die Städte nach wie vor sehr, wobei die höchsten Belastungen in Städten im Norden und Osten Europas (Schweden, Belgien, Niederlande und Finnland) und deutlich niedrigere Konzentrationen in Städten im Süden gemeldet wurden. Doch auch hier meldete mehr als die Hälfte (28 von 55) der Städte, aus denen Daten für 2021 und 2020 vorliegen, einen Anstieg der Rückstände.
Cannabis
Die höchsten Konzentrationen des Cannabismetaboliten (THC-COOH) wurden in west- und südeuropäischen Städten festgestellt, insbesondere in Kroatien, Tschechien, Spanien, den Niederlanden, Slowenien und Portugal. Der Konsum scheint von den COVID-19-Lockdowns weniger betroffen zu sein als andere Drogen. 2021 meldete fast die Hälfte der Städte (13 von 31), die Cannabismetaboliten analysierten, einen Anstieg der Cannabisbelastung.
MDMA
In den meisten untersuchten Städten war dies die einzige Droge, bei der die Rückstände zurückgingen. Fast zwei Drittel der Städte, aus denen Daten für 2021 und 2020 vorliegen (38 von 58), meldeten für 2021 einen Rückgang der Belastung, möglicherweise aufgrund der Schließung von Nachtclubs während der COVID-19-Pandemie, in denen diese Droge häufig konsumiert wird. Die höchsten MDMA-Rückstände wurden in Städten in Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Norwegen gefunden.
Städtische Variationen
Die Studie zeigte Unterschiede zwischen Städten innerhalb eines Landes auf, die teilweise auf ihre unterschiedlichen sozialen und demografischen Merkmale (Altersverteilung, Universitäten, Nachtleben) zurückzuführen sind. In den meisten Ländern mit mehreren Studienstandorten waren die Rückstände bei drei der Stimulanzien in Großstädten höher als in kleineren Ortschaften. Bei Amphetamin und Cannabis wurden keine derartigen Unterschiede festgestellt. Siebzehn der Länder, die 2021 an der Datenerhebung teilnahmen, nahmen mit zwei oder mehr Studienstandorten teil.
Wöchentliche Muster
Mit der Abwasseranalyse können wöchentliche Muster des Drogenkonsums festgestellt werden. Mehr als drei Viertel der Städte wiesen am Wochenende (Freitag–Montag) höhere Rückstände der typischen Freizeitdrogen Kokain und MDMA auf als an Wochentagen, obwohl ein Großteil der Nachtleben-Veranstaltungen in Europa im Jahr 2021 noch immer geschlossen war. Dagegen waren die Rückstände der anderen drei Drogen gleichmäßiger über die gesamte Woche verteilt.
Interaktive Funktionen
Die aktuelle Studie beinhaltet eine innovative interaktive Karte, die es den Benutzern ermöglicht, geografische und zeitliche Muster zu betrachten und die Ergebnisse nach Stadt und Droge heranzuzoomen. Im Einklang mit der Verpflichtung der EMCDDA, Daten zugänglich zu machen, können alle Quellentabellen hinter dem Tool von Forschern, Datenjournalisten oder allen, die daran interessiert sind, die Daten bei ihrer Arbeit zu verwenden, problemlos heruntergeladen werden.
Anmerkung: Die Proben aus 2021 wurden möglicherweise während der COVID-19-Beschränkungen erhoben, die sich auf die Verfügbarkeit und die Konsummuster von Drogen ausgewirkt haben könnten.
Pressestelle der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), 17.3.2022

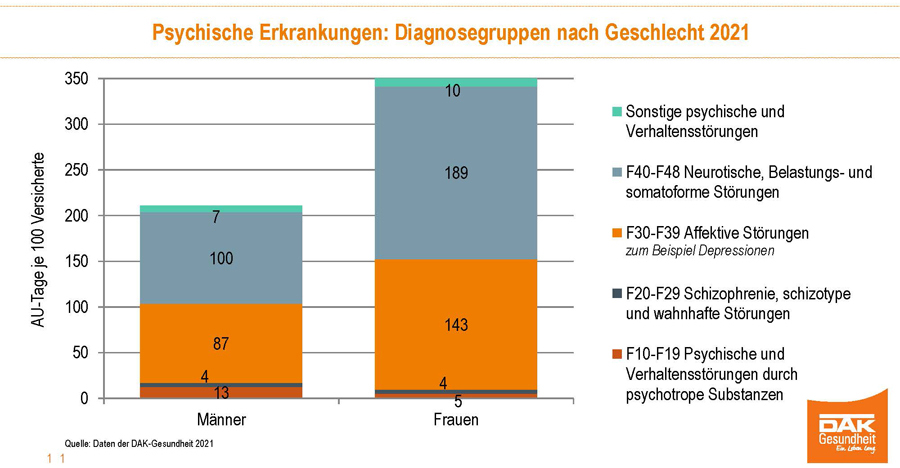
 Rauchen ist nach wie vor eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Zwar sinken die Konsumraten bei deutschen Jugendlichen seit Jahren nahezu kontinuierlich, bei den Erwachsenen sind sie während der Corona-Pandemie nach Jahren der Stagnation sogar wieder gestiegen. „Es wäre also dringend nötig, mehr Menschen zu motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören“, sagt Prof. Dr. Heino Stöver, geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung (ISFF) an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Centre for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt (CDR) und des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) ist er an einem neuen Forschungsprojekt beteiligt, das Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, näher untersucht. „Mindestens jeder fünfte Raucher bzw. jede fünfte Raucherin in Deutschland versucht einmal im Jahr, das Rauchen aufzugeben, das zeigen repräsentative Studien. Dabei wurden evidenzbasierte Rauchentwöhnungsmethoden eher selten genutzt“, sagt Kirsten Lehmann vom ZIS in Hamburg.
Rauchen ist nach wie vor eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Zwar sinken die Konsumraten bei deutschen Jugendlichen seit Jahren nahezu kontinuierlich, bei den Erwachsenen sind sie während der Corona-Pandemie nach Jahren der Stagnation sogar wieder gestiegen. „Es wäre also dringend nötig, mehr Menschen zu motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören“, sagt Prof. Dr. Heino Stöver, geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung (ISFF) an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Centre for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt (CDR) und des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) ist er an einem neuen Forschungsprojekt beteiligt, das Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, näher untersucht. „Mindestens jeder fünfte Raucher bzw. jede fünfte Raucherin in Deutschland versucht einmal im Jahr, das Rauchen aufzugeben, das zeigen repräsentative Studien. Dabei wurden evidenzbasierte Rauchentwöhnungsmethoden eher selten genutzt“, sagt Kirsten Lehmann vom ZIS in Hamburg.


