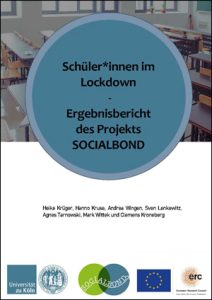Unter dem Vorsitz von Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht und Johannes-Wilhelm Rörig, dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kamen am 29. Juni erneut über 40 staatliche und nicht-staatliche Spitzenakteure zum Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zusammen. Anderthalb Jahre nach seiner konstituierenden Sitzung legte das Forum nun eine „Gemeinsame Verständigung“ vor. Darin sind konkrete Maßnahmen in fünf Themenkomplexen enthalten. Ziel ist es, Schutz und Hilfen bei sexualisierter Gewalt und Ausbeutung zu verbessern, kindgerechte Gerichtsverfahren zu gewährleisten und die Forschung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt weiter voranzubringen.
Unter dem Vorsitz von Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht und Johannes-Wilhelm Rörig, dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kamen am 29. Juni erneut über 40 staatliche und nicht-staatliche Spitzenakteure zum Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zusammen. Anderthalb Jahre nach seiner konstituierenden Sitzung legte das Forum nun eine „Gemeinsame Verständigung“ vor. Darin sind konkrete Maßnahmen in fünf Themenkomplexen enthalten. Ziel ist es, Schutz und Hilfen bei sexualisierter Gewalt und Ausbeutung zu verbessern, kindgerechte Gerichtsverfahren zu gewährleisten und die Forschung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt weiter voranzubringen.
Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs: „Für den Betroffenenrat sind die Zwischenergebnisse des Nationalen Rates eine wichtige Bestandsaufnahme und Bündelung von konkreten nächsten Schritten. Über 35 Jahre ehrenamtliches und professionelles Engagement insbesondere in Fachberatungsstellen, aber auch die vergangenen elf Jahre haben gezeigt, dass der Kampf gegen sexualisierte Gewalt und ihre Folgen nur gelingen kann, wenn klare und kontinuierlich finanzierte Rahmenbedingungen geschaffen werden. Im Mittelpunkt des Handelns müssen zwingend die Beteiligung und die Bedarfe von Betroffenen stehen. Notwendig sind der konsequente Ausbau von spezialisierten Fachberatungsstellen, die umfassende Implementierung von Kinderrechten sowie die inhaltliche Verankerung spezifischer Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes – in allen Bereichen der Gesellschaft. Alle Bundesländer sind gefordert, spezielle Strukturen gegen sexualisierte Gewalt zu schaffen. Unser gemeinsames Ziel ist die längst überfällige gesamtgesellschaftliche Verantwortungsübernahme, denn alle Betroffenen haben unabhängig vom Tatkontext das Recht auf Schutz und Aufarbeitung, Unterstützung und Hilfen.“
Kernpunkte der Gemeinsamen Verständigung im Überblick:
- Weiterer Ausbau von Schutzkonzepten und deren konsequente Anwendung
Schutzkonzepte sind für Einrichtungen und Organisationen, die Kinder und Jugendliche betreuen, zentral, um sie vor sexueller Gewalt zu schützen und Aufdeckung von Gewalttaten zu fördern. Daher hat der Nationale Rat über die Gelingensbedingungen (insbesondere gute Rahmenbedingungen, Qualifizierung, Partizipation und Vernetzung) beraten. Die Länder bekräftigen diese Anstrengungen mit einem Beschluss zur Umsetzung von Schutzkonzepten in Schulen.
- Vernetzte Hilfen für Unterstützung von Betroffenen
Die Kompetenzen unterschiedlicher Berufsgruppen spielen bei der Aufdeckung sexualisierter Gewalt und zur wirksamen Hilfe eine wichtige Rolle. Die Systeme der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Gesundheitswesens und der Sozialen Entschädigung müssen gut zusammenarbeiten und Kinder und mögliche Gewaltkontexte mit geschultem Blick betrachten. Die verbesserte Qualifizierung und Vernetzung dieser Akteure sollen dazu dienen, Gefahren für Kinder schneller zu erkennen und entsprechend zu helfen.
- Kindgerechte gerichtliche Verfahren qualifizieren Entscheidungen
Der Nationale Rat möchte die Rahmenbedingungen für Vernehmungen und Anhörungen im familiengerichtlichen und im Strafverfahren verbessern. Dazu wurden Praxishilfen für kindgerechte Verfahren entwickelt. Die Länder bekräftigen diese Anstrengungen mit einem Beschluss zur besseren Umsetzung der Videovernehmung.
- Schutz vor Ausbeutung und internationale Kooperation
Der Nationale Rat verfolgt das Ziel, die Identifizierung von minderjährigen Betroffenen des Menschenhandels strukturell zu befördern. Außerdem sollen spezifische Hilfen wie bedarfsgerechte Unterbringungsangebote verbessert und die Zusammenarbeit von Fachkräften gestärkt werden. Die neue Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz soll mit dem Nationalen Rat Schutzkonzepte für den digitalen Raum erarbeiten, um Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Ausbeutung zu schützen. Zur organisierten und rituellen Gewalt sollen Maßnahmen zur Aufklärung und Sensibilisierung vorangebracht werden.
- Leitlinien für die Konzeption von Häufigkeitsforschung zu (sexueller) Gewalt
Der Nationale Rat hat den Bedarf für eine verbesserte Datengrundlage zu Ausmaß und Erscheinungsformen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche identifiziert und sich auf konkrete Leitlinien für die Konzeption von Häufigkeitsforschung verständigt. Sie sollen helfen, mehr Wissen über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu generieren. Das ist die Grundlage guter politischer Entscheidungen.
Über den Nationlaen Rat
Dem Nationalen Rat gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft, Betroffene sowie Verantwortliche aus der Zivilgesellschaft und der Fachpraxis an. Das Gremium auf Spitzenebene und fünf thematische Arbeitsgruppen umfassen insgesamt etwa 300 Mitwirkende. Sie alle wollen das bestehende Ausmaß an sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche nicht hinnehmen und haben sich zum gemeinsamen Ziel gesetzt, sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und deren Folgen dauerhaft entgegenzuwirken. Seit der Konstituierung des Nationalen Rates am 2. Dezember 2019 durch das Bundesfamilienministerium und den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs hat der Nationale Rat in fünf thematischen Arbeitsgruppen getagt: Schutz, Hilfen, Kindgerechte Justiz, Schutz vor Ausbeutung und internationale Kooperation sowie Forschung und Wissenschaft.
Die „Gemeinsame Verständigung“ des Nationalen Rates finden Sie unter:
https://www.nationaler-rat.de/ergebnisse
Weitere Informationen unter:
https://www.nationaler-rat.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/
Pressestelle des Bundesfamilienministeriums, 30.6.2021