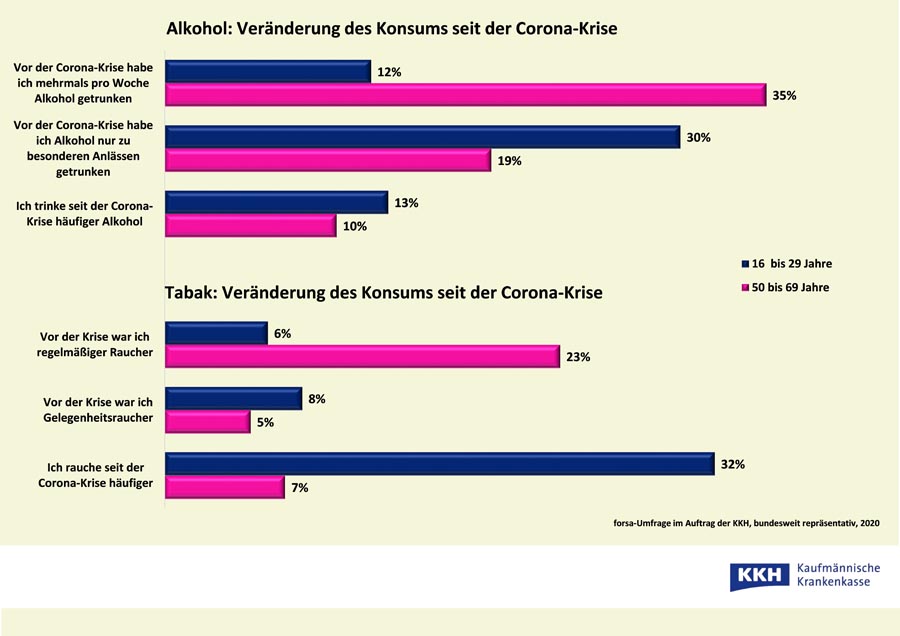Kommentar aus der Praxis
Soziale Medien sind mittlerweile fester Bestandteil der Lebenswelten vieler Menschen. Jugendliche und junge Erwachsene nutzen sie täglich, für junge Menschen sind die sozialen Netzwerke ständiger Begleiter. Maya Götz vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) zeigt in ihren Studien eindrücklich, welch große Bedeutung in diesem Zusammenhang Influencer_innen bekommen haben. Sie sind längst Vorbilder für junge Menschen geworden, die Körper- und Schönheitsideale sowie Lebensentwürfe beeinflussen (vgl. Götz, Wunderer et al. 2019; Götz 2019).
Die Pubertät als verletzliche Phase bringt Turbulenzen und wichtige Entwicklungen mit sich. Sozialarbeiter_innen, die mit Jugendlichen arbeiten – egal in welchem Kontext –, müssen sich mit dem Online-Nutzungsverhalten der Jugendlichen beschäftigen. Dabei geht es nicht darum, in ihre Lebenswelten einzudringen, sondern Ziel ist, einen Überblick über relevante Themen zu bekommen, die sie beschäftigen, um wiederum als informierte Gesprächspartner_innen zur Verfügung stehen zu können.
Aus unserer Präventions- und Beratungsarbeit mit jungen Menschen mit Essstörungen bei „sMUTje“ in Hamburg wissen wir, dass es diesen Zugang braucht, um proaktiv Themenbereiche anzusprechen, die Jugendlichen unangenehm sind oder über die sie mit Eltern oder anderen Bezugsperson nicht reden möchten oder können. In der Arbeit geht es darum, eine tragfähige Beziehung aufzubauen, in der die Jugendlichen sich uns mit ihren Nöten und Ängsten anvertrauen können. Dazu gehört auch, dass wir nicht nur die Symptomatik kennen, sondern auch Einblick in ihre Lebenswelt bekommen. Für viele Klient_innen spielen soziale Medien eine große Rolle, von der sie erst dann erzählen, wenn wir aktiv danach fragen.
Soziale Medien und Essstörungen
Götz zeigt, dass Essstörungen durch Influencer_innen gefördert werden können. Menschen mit Essstörungen bewerten ihre Körper meist kritisch, sind häufig perfektionistisch, verbunden mit einem meist niedrigen Selbstwertgefühl. Dies erklärt ihre starke Orientierung an der Bewertung von anderen. Der deutliche Einfluss von Influencer_innen auf Ideale, Körperbilder, Trainings- und Ernährungsverhalten wurde von Götz nachgewiesen (vgl. Götz, Wunderer et al. 2019).
Gleichzeitig können soziale Medien auch genutzt werden, um den Weg der Gesundung zu unterstützen: wenn Betroffene sich gegenseitig stärken, sich für „Body Positivity“-Beiträge interessieren oder beispielsweise Recovery Accounts nutzen (vgl. Götz, Wunderer et al. 2019).
Datenschutz
Als professionelle Helfer_innen stehen wir in der Verantwortung, die Medienkompetenz zu stärken und Jugendliche zu ermutigen, sich mit Geschlechterrollen, Körperbildern und Idealen kritisch auseinanderzusetzen. Leider verhindern es momentan Vorgaben zur Wahrung des Datenschutzes, dass wir in unserer täglichen Arbeit soziale Medien nutzen. Dabei geht es nicht nur darum, etwas aktiv zu posten. Selbst das Verfolgen und Teilen von Beitragen ist derzeit unmöglich.
Unstrittig ist, dass Datenschutz oberste Priorität in unserer Arbeit hat. Nur so können wir einen geschützten professionellen Rahmen bieten. Nichtsdestotrotz darf es nicht sein, dass sich das Arbeitsfeld Prävention aus Datenschutzgründen dem Thema Soziale Medien verschließt und Sozialarbeiter_innen ihr Wissen alleine aus ihrem privaten Umfeld beziehen. Dann würden wir Jugendliche mit ihren Erfahrungen alleine lassen und in dieser sich schnell entwickelnden Welt den Anschluss verlieren – und damit auch den Zugang zu den Jugendlichen. Sind wir keine informierten Gesprächspartner_innen mehr, weil wir einen wichtigen Teil der Lebenswelt der Jugendlichen nicht mehr verstehen, vergeben wir Chancen für eine vertrauensvolle Beziehung und die Potenziale, die sich daraus ergeben.
Wir sind aufgefordert, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, uns dem Bereich der Online-Beratung und den sozialen Medien zuzuwenden und dabei den Datenschutz zu wahren. Nur wenn wir uns fortbilden und entsprechende Tools anbieten, können wir die Kompetenzen von Jugendlichen stärken und ein authentisches Gegenüber sein.
Erkenntnisse aus der Wissenschaft
Influencer_innen fördern unrealistische Körperwahrnehmung und Essstörungen
Social Media Aktivität alleine begründet keine Essstörung. Viele Jugendliche erkranken nicht. Essstörungen entstehen durch das Zusammenspiel verschiedener bio-psycho-sozialer Faktoren. Die Erkrankung stellt einen Lösungsversuch dar und ist Ausdruck tieferliegender Konflikte und Belastungen. Bei individueller Verletzlichkeit, Vorbelastung oder manifestierter Essstörung können soziale Medien ein relevanter Faktor sein, der die Erkrankung auslöst, verstärkt oder zur Aufrechterhaltung beiträgt.
Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) hat in Kooperation mit dem Bundesfachverband Essstörungen (BFE) und der Schönklinik eine Studie durchgeführt, die die Bedeutung von Influencer_innen bei der Entwicklung von Essstörungen untersucht (Götz, Wunderer et al. 2019). Teilgenommen haben 143 Betroffene, die an einer Essstörung erkrankt sind und sich zum Zeitpunkt der Befragung in Behandlung befinden. Die Teilnehmenden sind zwischen 13 und 52 Jahre alt, die Gruppe setzt sich zusammen aus 138 Frauen, vier Männern und einer non-binären Person.
Ergebnisse der Studie des IZI (Götz, Wunderer et al. 2019, S. 29 f.):
- Menschen mit Essstörungen sind meist unzufrieden mit dem eigenem Körper, es finden sich oft ein hoher Grad an Perfektionismus sowie eine starke Orientierung an der Bewertung von anderen.
- Influencer_innen haben deutlichen Einfluss auf Ideale, Körperbilder sowie Trainings- und Ernährungsverhalten und können Essstörungen unterstützen.
- Menschen mit Essstörungen nutzen Instagram in ähnlicher Weise wie andere Gleichaltrige. Mädchen und Frauen mit Essstörungen haben aber häufig ein überkritisches Verhältnis zu ihrem Körper und Selbstzweifel. Sie machen sich noch mehr Gedanken über Likes und Kommentare und benutzen häufiger als repräsentativ befragte Mädchen und Frauen Filter-Software zur Bearbeitung ihrer Fotos.
- Acht von zehn Betroffenen (77 Prozent) stimmen zu, dass die Bearbeitung von Fotos auch Veränderungen im realen Leben (z. B. in ihrem Sport- und Ernährungsverhalten) ausgelöst hat.
- Für viele der Befragten waren bestimmte Influencer_innen von Bedeutung (Sport, Fitness, Beauty) und führten zur Übernahme der Körperbild-Ideale sowie des Sport- und Ernährungsverhaltens.
„Influencer_innen bestimmten die aktuellen Trends der Jugendkultur. Sie beeinflussen, indem sie (scheinbar) authentisch und völlig offen einen Blick in ihre Lebenswelt gewähren, und setzen so nicht nur Trends, was Marken und Mode angeht, sondern werben für bestimmte Lebensweisen und Produkte, die unhinterfragt als Ideale angenommen werden.“ (Götz, Wunderer et al. 2019, S. 31)
- Chancen: Influencer_innen und die Nutzung sozialer Medien können auch ein Beitrag zur Heilung sein (Body Positivity, unbearbeitete Bilder/Realität sehen und akzeptieren, Erweiterung von Schönheitsidealen, positive Auseinandersetzung mit dem Körper, Förderung von Diversität).
Influencer_innen sind Vorbilder und haben Einfluss auf Körperbilder, Trainings- und Ernährungsverhalten, Geschlechterrollen sowie Lebensentwürfe
In einer andern Studienreihe untersuchte das IZI gemeinsam mit der MaLisa Stiftung, was die Selbstinszenierung von erfolgreichen Influencer_innen auf Instagram kennzeichnet und welche Bedeutung dies für die Selbstinszenierung von Mädchen auf Instagram haben kann.
Ergebnisse der Studienreihe (vgl. Götz 2019):
- Instagram ist nach Youtube und WhatsApp das beliebteste Internetangebot mit steigender Nachfrage. Insbesondere Jugendliche (73 Prozent) nutzen Instagram täglich oder mehrmals pro Woche (S. 25).
- Influencer_innen sind „die neuen Vorbilder heutiger Preteens und Jugendlicher“ (S. 25).
- Instagram wird zurzeit weltweit als größte Plattform der visuellen Selbstdarstellung von Jugendlichen genutzt. Insbesondere Mädchen und junge Frauen veröffentlichen hier Bilder von sich und stellen ihr Leben und ihre Identität vor. Die aufwendige Selbstinszenierung und Bearbeitung der Bilder lässt keinen Platz für die meisten Alltagserlebnisse und die meisten Facetten der Persönlichkeit in der Selbstdarstellung zu (S. 27 f.).
- Eine repräsentative Stichprobe (N=846 junge Menschen zwischen zwölf und 19 Jahren, davon 404 Mädchen) zeigt:
„Drei Viertel aller Mädchen laden zumindest manchmal Bilder auf sozialen Netzwerken hoch. In dieser Selbstinszenierung ist es Mädchen besonders wichtig, sich ‚gut gelaunt‘ (90 Prozent) und von ihrer besten Seite (87 Prozent) zu zeigen und dabei gleichzeitig möglichst natürlich auszusehen (88 Prozent). Um dies zu erreichen, nutzen 49 Prozent der Mädchen zumindest manchmal Filter-Software, ohne dass dies im Widerspruch zu dem Wunsch, ‚natürlich‘ auszusehen, stehen würde“ (S. 28).
- Influencer_innen als neue Vorbilder prägen Schönheitsideale, Vorstellungen von Geschlechterrollen und Lebensentwürfe. Sie vertreten dabei Interessen der Schönheits- und Modeindustrie, was für Außenstehende nicht mehr erkennbar ist (S. 25 f.).
- Instagram ist eine Plattform zur Selbstdarstellung. Bilder, die gepostet werden, sind nicht zufällig entstanden, sondern wurden aufwendig inszeniert und nachbearbeitet. Es wird eine perfekte Welt dargestellt, die den Betrachter_innen suggeriert, es handele sich um einen spontanen Einblick in eine „natürliche“ Welt (S. 28). Dadurch kommt es einer „Verzerrung des Verständnisses von „natürlich“ und „spontan“ (S. 28).
Positive Beispiele von Online-Angeboten – Beratung, Krisenbegleitung, Psychoedukation
Incogito: Peer-Projekt, Recovery, Online-Beratung durch Fachkräfte:
https://in-cogito.de
U25: Suizidprophylaxe, Peer-Projekt, begleitet durch Caritas:
https://www.u25-deutschland.de/
Ernährungsprotokoll-App Jourvie:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/193010/Essstoerungen- Digitales-Essprotokoll-unterstuetzt-bei-Therapie
Bauchgefühl: Onlineportal mit Podcast, Videos (BKK):
https://www.bkk-bauchgefuehl.de/
Waage e.V.: Podcasts mit Betroffenen und Angehörigen:
https://www.waage-hh.de/mediathek-alt/essgeschichten/
Waage e.V.: Videos zu Recovery, Betroffene berichten:
https://www.youtube.com/user/essberatung/videos
Ninette Online-Comic und Beratungstool:
https://ninette.berlin/mainsite/
Filmbeitrag von sMUTje zum Thema „Social Media und Essstörungen“:
https://www.prosieben.de/tv/taff/video/2020211-instarexie-wenn-instagram-zur-magersucht-fuehrt-clip
Literatur:
- Götz, Maya; Wunderer, Eva; Greithanner, Julia; Maslanka, Eva (2019): „Warum kann ich nicht so perfekt sein?“ Die Bedeutung von Influencerinnen bei der Entwicklung von Essstörungen, in: TELEVIZION, München, online verfügbar: https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/32_2019_1/Goetz_Wunderer-perfekt_sein.pdf (16.02.2021)
- Götz, Maya (2019): Die Selbstinszenierung von Influencerinnen auf Instagram und ihre Bedeutung für Mädchen. Zusammenfassung der Ergebnisse einer Studienreihe, in: TELEVIZION, München, online verfügbar: https://www.br- online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/32_2019_1/Goetz-Die_Selbstinszenierung_von_Influencerinnen.pdf (16.02.2021)
Kontakt:
Ina Janßen
Klinische Sozialarbeiterin MA
Therapiehilfe gGmbH
sMUTje Starthilfe für MUTige Jugendliche mit Essstörungen
Ritterstraße 69, 22089 Hamburg
Tel. 040-2000 10 54 14 oder 040-2000 10 54 08
ina-janssen(at)therapiehilfe.de