 Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) im Zeitraum vom 5. bis zum 22. Mai 2020 die Einflüsse virtueller Arbeit, insbesondere dem Homeoffice, auf die Unternehmenspraxis untersucht und die Ergebnisse in der Studie „Arbeiten in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum New Normal“ zusammengefasst. Die Studie wurde am 9. Juli 2020 veröffentlicht.
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) im Zeitraum vom 5. bis zum 22. Mai 2020 die Einflüsse virtueller Arbeit, insbesondere dem Homeoffice, auf die Unternehmenspraxis untersucht und die Ergebnisse in der Studie „Arbeiten in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum New Normal“ zusammengefasst. Die Studie wurde am 9. Juli 2020 veröffentlicht.
In einer gemeinsam angelegten Studie haben das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) die Auswirkungen, Chancen und Erfahrungen virtueller Arbeitsformen in der Corona-Pandemie analysiert. An der Befragung nahmen über 500 Unternehmen teil. Im Fokus der Studie standen Fragen nach den Veränderungen der Arbeitsorganisation, der Bewältigung von Kundenkontakten sowie technischen Herausforderungen für Mitarbeitende und Unternehmen. Im Vordergrund stand darüber hinaus die Einschätzung der Unternehmen dazu, wie es im „New Normal“ weitergehen kann und welche technischen, kulturellen sowie führungsseitigen Voraussetzungen hierfür noch geschaffen werden müssen.
„Die Ergebnisse sind beeindruckend“, sagt die Studienleiterin Dr. Josephine Hofmann vom Fraunhofer IAO. „Wir erleben ein großflächiges, bundesweites Experiment der Digitalisierung von Arbeit und Kooperation, dessen Veränderungsgeschwindigkeit bis vor kurzem noch undenkbar erschien. Besonders bemerkenswert finde ich das agile, schnelle Vorgehen in den Unternehmen und den Mut, Neues, auch notgedrungen, schnell umzusetzen“, ergänzt Hofmann.
70 Prozent im Homeoffice – das „New Normal“ zu Corona-Zeiten
Besonders die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Umsetzung von Arbeit auf Distanz sind hoch. Fast 70 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Angestellten in der Corona-Phase komplett im Homeoffice arbeiten. Bei gut 21 Prozent wird das Modell einer 50:50-Aufteilung gewählt. Vor der Corona-Krise war der Anteil der daheim arbeitenden Mitarbeitenden deutlich geringer. Auch Geschäftsreisen und Kundenveranstaltungen wurden weitgehend virtualisiert und mit digitalen Formaten abgewickelt. Gleiches gilt für zentrale Personalprozesse, die bisher fast ausschließlich in physischer Präsenz abgewickelt wurden, wie z. B. Bewerber- und Einstellungsgespräche. 57 Prozent gaben an, die Gespräche erstmalig virtuell durchzuführen. Bei Mitarbeitergesprächen lag der Anteil bei 62 Prozent und beim Kundendialog bei 72 Prozent. „Die Zahlen veranschaulichen, welchen großen Einfluss Corona nicht nur auf das zwischenmenschliche Miteinander hat, sondern auch auf die Unternehmenswelt. Die digitale Transformation in Arbeitsprozessen hat einen gewaltigen Schub bekommen“, erklärt Kai Helfritz von der DGFP. „Das ›New Normal‹ oder auch das ›New Different‹ wird in einem deutlich höheren Maß von einem Nebeneinander virtueller und im Büro stattfindenden Arbeits- und Kooperationsformen gekennzeichnet sein“, ergänzt Josephine Hofmann.
47 Prozent der Befragten haben bestätigt, dass gerade Führungskräfte Vorbehalte abgebaut haben. Erwartungsgemäß hat die Studie auch klare Nachbesserungspotenziale sichtbar gemacht: bei Führung über Distanz, beim Management von Entgrenzung aber auch bei technischen Themen wie digitale Signaturen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Arbeits- und Kooperationsprozesse insgesamt deutlich stärker virtualisierbar sind, als bisher angenommen.
Die Studie steht ab sofort kostenlos im Internet zur Verfügung. Das Fraunhofer IAO bietet Unternehmen oder Organisationen darüber hinaus eine individuelle Bestandsaufnahme an. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragen darin Mitarbeitende und Führungskräfte systematisch nach ihrer Einschätzung und werten die Ergebnisse organisationsspezifisch für die strategische Planung des beauftragenden Unternehmens aus. Interessierte Unternehmen können sich bei Interesse direkt an Dr. Josephine Hofmann wenden.
Originalpublikation:
Hofmann, Josephine; Piele, Alexander; Piele, Christian: Arbeiten in der Corona-Pandemie– Auf dem Weg zum New Normal. Studie des Fraunhofer IAO in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP e.V. http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-593445.html
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, 09.07.2020





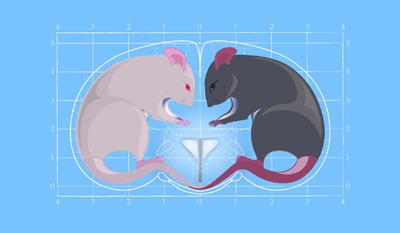
 Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer einen neuen Leitfaden zum Thema Alkoholkonsum entwickelt. Der Leitfaden unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Gespräche zum Thema Alkohol mit Patientinnen und Patienten so zu führen, dass diese sich gut beraten fühlen. Unter dem Titel „Alkoholkonsum bei Patientinnen und Patienten ansprechen. Ärztliches Manual zur Prävention und Behandlung von riskantem, schädlichem und abhängigem Konsum“ ist der Leitfaden ab sofort kostenfrei bei der BZgA bestellbar.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer einen neuen Leitfaden zum Thema Alkoholkonsum entwickelt. Der Leitfaden unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Gespräche zum Thema Alkohol mit Patientinnen und Patienten so zu führen, dass diese sich gut beraten fühlen. Unter dem Titel „Alkoholkonsum bei Patientinnen und Patienten ansprechen. Ärztliches Manual zur Prävention und Behandlung von riskantem, schädlichem und abhängigem Konsum“ ist der Leitfaden ab sofort kostenfrei bei der BZgA bestellbar.

