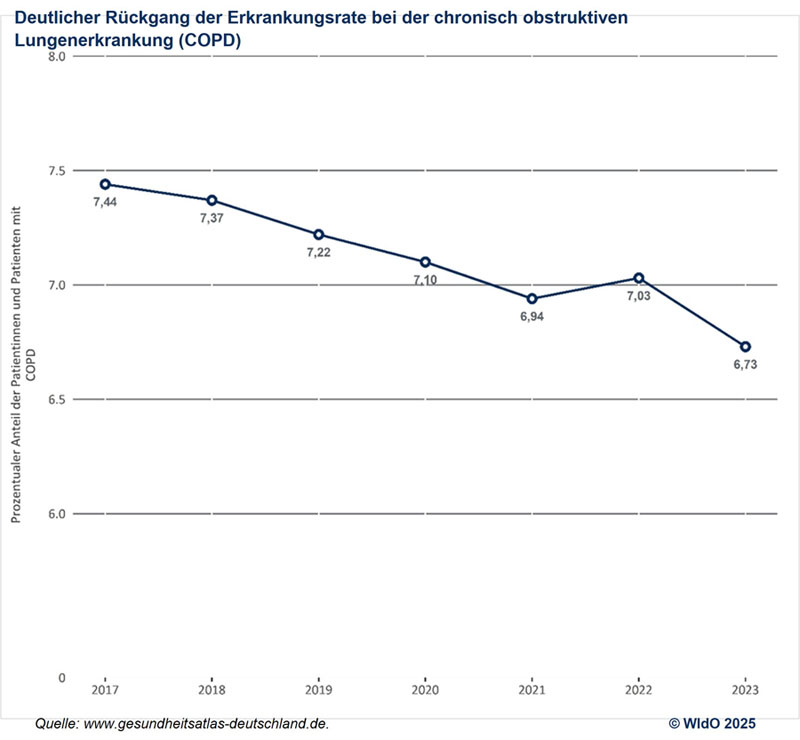Der Zweite Weltkrieg hinterließ nicht nur Millionen Tote, sondern auch gravierende psychische Spuren bei den Überlebenden. Am härtesten traf dies jüdische Menschen, die der Shoa entkommen waren, und die zahlreichen weiteren Opfer der Deutschen. Viele Menschen wurden durch Tod, Vertreibung und Gewalterfahrungen traumatisiert. Achtzig Jahre später belegen zwei aktuelle Forschungsprojekte des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZPG), wie die Folgen psychischer Traumatisierung bei nachfolgenden Generationen wirken können.
Eindrücklich dokumentiert ist das bei Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Doch auch Kinder und Enkel der Tätergeneration, Menschen mit Unrechtserfahrungen aus der DDR sowie Geflüchtete aus aktuellen Kriegs- und Krisengebieten sind betroffen. Sie alle eint: Die psychischen und biologischen Folgen extremer Belastungen lassen sich nicht immer auf eine Generation begrenzen, denn sie können Spuren in familiären Beziehungen und sogar im Erbgut hinterlassen.
Wie kommen Spuren von Traumata ins Erbgut?
Prof. Dr. Dr. Elisabeth Binder, seit 2013 Direktorin und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, untersucht, wie sich extreme Belastungen wie Krieg oder Verfolgung biologisch „einschreiben“. Forschung zeigt: Die Stresshormonachse von Kindern traumatisierter Eltern – etwa von Holocaust-Überlebenden – ist nachweislich verändert. Binders Forschung fokussiert auf die epigenetischen Mechanismen, die solche Veränderungen erlauben. „Wir sehen Veränderungen in der epigenetischen Regulation von Genen, die für die Stressverarbeitung wichtig sind“, erklärt Binder. Ein Beispiel ist das Gen FKBP5: In Kooperation mit der renommierten Trauma-Forscherin Rachel Yehuda konnte Binder hier Unterschiede in der Gen-Methylierung bei Kindern von Holocaust-Überlebenden nachweisen. Diese biologischen Veränderungen beeinflussen die Stressresilienz möglicherweise über mehrere Generationen.
In einem DZPG-Projekt untersucht Binder mit Kollegen mittels Biomarkern und Modellsystemen, wie das Risiko für psychische Erkrankungen über Generationen weitergegeben werden kann. Vorgeburtliche Stressbelastung konnte Binder auch in Nabelschnurblut nachweisen – durch epigenetische Marker, die mit mütterlicher Depression und Angst in der Schwangerschaft und auch mit der späteren Inanspruchnahme medizinischer und psychologischer Hilfe durch die Kinder korrelieren. In sogenannten Hirnorganoiden, winzigen Gehirnmodellen aus Stammzellen, ließ sich zudem beobachten, dass vorgeburtliche Stresshormone die neuronale Entwicklung beeinflussen kann. Das Ziel der Forschung: frühe Indikatoren identifizieren und präventiv eingreifen können.
Weitergabe durch gestörte Interaktionen
Auch auf der psychologischen Ebene zeigt sich, dass Traumata nachwirken können. Hanna Christiansen, Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Philipps-Universität Marburg, untersucht in einem Projekt am DZPG-Standort Bochum-Marburg, wie psychische Erkrankungen in Familien durch gestörte Interaktionen und belastende Lebensbedingungen weitergegeben werden. Ihre Forschung zeigt: Kinder psychisch erkrankter Eltern entwickeln mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit selbst psychische Auffälligkeiten. Oft sind es feine, alltägliche Mechanismen – mangelnde Responsivität, fehlende Struktur oder überfordernde emotionale Zustände –, die sich auf das kindliche Erleben und letztlich die psychische Gesundheit auswirken.
Forschung zeigt: Der Umgang mit Traumata ist auch heute eine wichtige Aufgabe
DZPG-Sprecher Prof. Peter Falkai ordnet die Forschung ein: „Beide Studien machen deutlich: Transgenerationale Trauma-Weitergabe ist kein abstraktes Phänomen, sondern eine vielschichtige Antwort des Individuums auf molekularer und psychischer Ebene.“ Sprecherin Prof. Silvia Schneider ergänzt: „Sie betrifft nicht nur Opfer des Nationalsozialismus, sondern zum Beispiel auch Menschen mit Unrechtserfahrungen in der DDR, Geflüchtete etwa aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine sowie nicht zuletzt Kinder in Deutschland, die mit psychisch kranken Eltern aufwachsen.“
Über das DZPG
Seit Mai 2023 arbeiten im Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) Expertinnen und Experten daran, durch gemeinsame Forschung die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. An sechs Standorten in Deutschland wirken hierfür Forscherinnen und Kliniker gemeinsam mit Expertinnen aus Erfahrung, also Betroffenen und ihnen Nahestehenden, sowie internationalen Wissenschaftlern zusammen. Unter www.dzpg.org finden Interessierte Informationen zur Organisation, zu Forschungsprojekten und Zielen sowie informative Texte und hilfreiche Links rund um das Thema psychische Gesundheit.
Pressestelle des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit, 5.5.2025