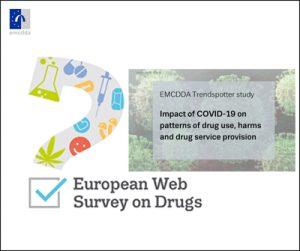Ist Soziale Arbeit eine Wissenschaft oder „nur“ ein Beruf? Schon seit Jahren beeinflusst die Debatte um Professionalisierung und Akademisierung dieses Berufsfeldes das Selbstverständnis von Fachkräften der Sozialen Arbeit. Theorien und Konzepte dieser Disziplin sind bisher jedoch noch nicht selbstverständlich in der praktischen Arbeit verankert. Einen Beitrag hierzu leistet die Bachelorarbeit von Bettina Bayer. Die Absolventin der FH Münster hat das Lebensbewältigungskonzept nach Lothar Böhnisch angewendet, um die verbreitete Praxis der Suchtberatung − gestützt auf diese Theorie − zu systematisieren. Dafür wurde sie von der Hochschule mit dem Preis für die beste Bachelorarbeit am Fachbereich Sozialwesen im Jahr 2019 ausgezeichnet.
„Meine Hypothese war, dass die ambulante Suchtberatung zwar nach den theoretischen Vorstellungen der Disziplin handelt, sich dessen aber meist nicht bewusst ist“, erklärt die 23-Jährige. Um dies zu ändern, zog sie Böhnischs Modell heran, das verschiedene Annahmen zum Verhalten von Menschen in kritischen Lebenskonstellationen formuliert. „Meine Ergebnisse zeigen, dass die Inhalte seines Lebensbewältigungskonzepts durchaus geeignet sind, um den Großteil des Erklärungs-, Beschreibungs- und Wertewissens der Suchtberatung zu systematisieren.“
Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen, ist der jungen Sozialarbeiterin schon seit dem zweiten Semester ein wichtiges Anliegen. Bereits damals hatte sie begonnen, sich als Tutorin näher mit der Professionalisierung ihrer Fachdisziplin zu befassen. „Nach meinem Praxissemester in der Suchtberatung war mir dann ziemlich schnell klar, worüber ich meine Abschlussarbeit schreiben wollte“, erinnert sich Bayer. Die Ergebnisse ihrer Arbeit kommen ihr jetzt auch in der Praxis zugute: Direkt nach ihrem Abschlusskolloquium hat sie begonnen, in der Fachstelle Suchtprävention der Caritas im Kreis Coesfeld zu arbeiten.
„Frau Bayer liefert mit ihrer Ausarbeitung eine für den begrenzten Rahmen einer Bachelorarbeit bemerkenswert eigenständigen und anspruchsvollen Beitrag zum Thema der Professionalisierung und damit Konturierung Sozialer Arbeit im Kontext der Suchthilfe, speziell im Bereich der ambulanten Suchtberatung“, sagt Prof. Dr. Martin Wallroth vom Fachbereich Sozialwesen. Er hatte Bayers Abschlussarbeit betreut und für den Preis vorgeschlagen.
Den Hochschulpreis erhält circa ein Prozent aller Absolventinnen und Absolventen eines Jahrgangs. Jedes Jahr kürt das Präsidium gemeinsam mit der Gesellschaft der Freunde der FH Münster e.V. (gdf) auf Vorschlag der Fachbereiche und der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung die besten Abschlussarbeiten. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern des Hochschulpreises 2020 für die besten Arbeiten aus 2019 gehört auch Bettina Bayer vom Fachbereich Sozialwesen. Eine vollständige Übersicht aller gewürdigten Absolventinnen und Absolventen ist im Jahresbericht 2019 ab Seite 46 abrufbar: fhms.eu/jahresbericht-19.
Interview mit Bettina Bayer auf der Website der FH Münster:
https://www.fh-muenster.de/sw/aktuelles/interneartikel/hochschulpreis-fuer-bettina-bayer.php
Pressestelle der FH Münster, 26. Mai 2020