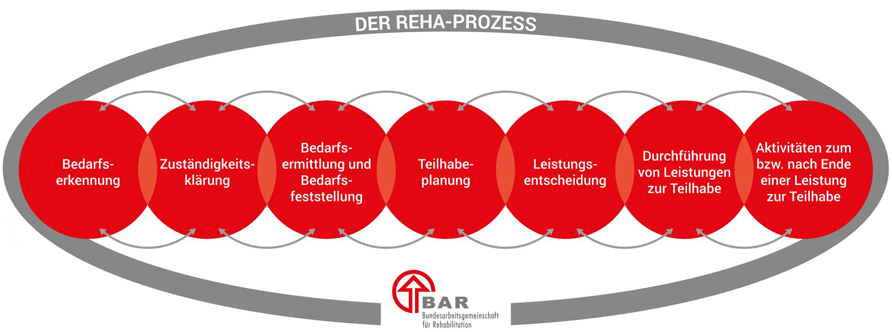Auf Initiative der AG Suchthilfe der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) und mit Finanzierung des Bundesgesundheitsministeriums haben sich im Januar 2020 in Essen 21 Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen der Suchthilfe (Verwaltung, Träger, Verbände, Fachverbände) mit Wissenschaftlern zu einem Fachgespräch getroffen. Ziel war die Verständigung über Bedingungen, die für eine gelingende Bewältigung des digitalen Wandels benötigt werden, und welche grundlegenden Aspekte dabei zu beachten sind.
Auf Initiative der AG Suchthilfe der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) und mit Finanzierung des Bundesgesundheitsministeriums haben sich im Januar 2020 in Essen 21 Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen der Suchthilfe (Verwaltung, Träger, Verbände, Fachverbände) mit Wissenschaftlern zu einem Fachgespräch getroffen. Ziel war die Verständigung über Bedingungen, die für eine gelingende Bewältigung des digitalen Wandels benötigt werden, und welche grundlegenden Aspekte dabei zu beachten sind.
Die vorliegenden „Essener Leitgedanken“ als Ergebnis des Fachgesprächs fassen thesenartig zusammen, wie die Suchthilfe gemeinsam mit den Verbänden und Leistungsträgern den digitalen Wandel für die Weiterentwicklung der Hilfeangebote nutzen kann. Das Papier kann damit erste Hinweise für Strategieentwicklungen sowohl auf einer übergeordneten Ebene als auch für die Träger vor Ort geben.
Die Einzigartigkeit und der Wert der Essener Leitgedanken liegt nicht in der Sammlung von möglichst vielen zu berücksichtigenden Aspekten, sondern darin, dass sich Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der Suchthilfe erstmals auf Basisaussagen für den digitalen Wandel in der Suchthilfe verständigt haben, die für das weitere Vorgehen richtungsweisend sein können.
Die Initiatorinnen und Initiatoren möchten mit den Leitgedanken den Diskurs zur Thematik bereichern. Sie sind sich bewusst, dass in der fachlichen Diskussion das Papier dann bestimmt noch die ein oder andere Ergänzung erfahren wird.
Dietrich Hellge-Antoni (Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg)
Wolfgang Rosengarten (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration)
Im Folgenden wird der vollständige Text der „Essener Leitgedanken“ (März 2020) wiedergegeben. Das Papier steht auch als PDF zum Download zur Verfügung (Klick auf die Abbildung oben).
DIGITAL handeln = Zukunft gestalten
Essener Leitgedanken zur digitalen Transformation in der Suchthilfe
Präambel
Das Suchthilfesystem in Deutschland bietet Menschen mit Suchtproblemen und ihren Angehörigen Unterstützung an. Mit seinen qualifizierten Beschäftigten und den ausdifferenzierten Angeboten erfreut es sich einer regen Nachfrage und findet international große Anerkennung.
Die technologieinduzierten gesellschaftspolitischen Entwicklungen bewirken hier jedoch Änderungen: gerade jüngere Zielgruppen bewegen sich zunehmend in digitalen Räumen (z. B. in sozialen Netzwerken). Dadurch haben sich auch die Wege der Informationsbeschaffung und der Informationsrezeption geändert. Mit den etablierten Strategien, Angeboten und Kommunikationsmedien der Suchthilfe werden diese Zielgruppen unzulänglich oder nicht erreicht. Digitale Angebote können diese Zielgruppen in ihren digitalen Lebenswelten erreichen.
Digitale Angebote bieten darüber hinaus die Chance weiteren Herausforderungen zu begegnen. Nicht nur in ländlichen Gebieten, in denen die Aufrechterhaltung einer gebotenen Versorgung, anders als in urbanen Räumen, schon von jeher strukturellen Herausforderungen gegenübersteht, bietet sich die Chance, durch die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten die Angebote aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Durch intelligente Programme kann zudem entgegengewirkt werden, dass zunehmend ausgedünnte Versorgungsstrukturen den Zugang zu Hilfeangeboten erschweren. Der vermehrte Fachkräftemangel führt bspw. dazu, dass es einerseits zu Versorgungseinschränkungen aber auch zu einer Verdichtung der Arbeit in den Suchthilfeeinrichtungen kommt.
Um auch in der Zukunft zeitgemäße und zielgruppenorientierte Suchthilfeangebote zu gewährleisten, ist es für die Suchthilfe unerlässlich, ihre digitale Transformation aktiv zu gestalten und bestehende analoge Angebote durch sinnvolle digitale Angebote zu ergänzen.
Auf Initiative der AG Suchthilfe der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) und mit Finanzierung des Bundesgesundheitsministeriums haben sich im Januar 2020 in Essen 25 Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen der Suchthilfe (Verwaltung, Träger, Verbände, Fachverbände) mit Wissenschaftlern zu einem Fachgespräch getroffen. Ziel war die Verständigung über Bedingungen, die für eine gelingende Bewältigung des digitalen Wandels benötigt werden und welche grundlegenden Aspekte dabei zu beachten sind.
Die vorliegenden „Essener Leitgedanken“ als Ergebnis des Fachgesprächs fassen thesenartig zusammen, wie die Suchthilfe gemeinsam mit den Verbänden und Leistungsträgern den digitalen Wandel für die Weiterentwicklung der Hilfeangebote nutzen kann. Das Papier kann damit erste Hinweise für Strategieentwicklungen sowohl auf einer übergeordneten Ebene als auch für die Träger vor Ort geben.
Leitgedanken
1. Die Zielgruppen im Blick
Digitale Angebote in der Suchthilfe sind konsequent an den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen ausgerichtet. Sie schließen Versorgungslücken, adressieren die gesamte Bevölkerung und bieten einfache Übergänge zwischen verschiedenen Maßnahmen. Die Zielgruppen erhalten damit schnell und frühzeitig Zugänge zum Suchthilfesystem (Suchtprävention, niederschwellige und aufsuchende Hilfen, Suchtberatung und Begleitung, Suchtbehandlung oder Suchtselbsthilfe).
2. Qualitätsstandards im virtuellen Raum sicherstellen
Auch für die digitalen Angebote gelten die fachlichen Standards der Suchthilfe. Die digitalen Informations- und Beratungsangebote sind unabhängig. Die Beratung ist grundsätzlich anonym, kostenlos und für alle frei zugänglich. Angebotene Programme und Apps, auch im Bereich der Therapie, unterliegen Qualitätskriterien. Sind aufgrund der Nutzung technischer Instrumente und Medien neue Qualitätsstandards notwendig, werden diese von der Suchthilfe initiiert, erarbeitet und weiterentwickelt.
3. Die digitale Transformation verändert Strukturen, Prozesse und Qualifikationen
Die digitale Transformation bedeutet weitaus mehr, als nur neue Informations-, Verwaltungs- und Kommunikationskanäle sowie Beratungs- und Behandlungsoptionen zu entwickeln und zu nutzen. Digitalisierung soll auch genutzt werden, um die Arbeitsstrukturen und Arbeitsprozesse in den Einrichtungen zu verbessern und sie nachhaltig zu optimieren. Die digitale Transformation stellt neue Anforderungen an die Träger und Fachkräfte. Dies erfordert u.a. Anstrengungen in der Personalentwicklung und entsprechende Angebote der Fort- und Weiterbildung.
4. Agilität ist gefragt
Um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern, sind neue Methoden und Arbeitsformate notwendig wie z. B. Barcamps, Design Thinking oder Co-Creation. Um diese Potentiale zu nutzen, sind Experimentierräume hilfreich, in denen zieloffen gearbeitet werden kann. Die hierfür notwendige Nutzung bestehender Netzwerke und Etablierung neuer agiler Organisationsformen bedürfen der Mitgestaltung und Mitverantwortlichkeit aller Beteiligten.
5. Das Gelingen der Digitalen Transformation benötigt adäquate Rahmenbedingungen
Die aktuellen Strukturen und Entscheidungswege in der Suchthilfe, aber auch auf administrativ-politischer Ebene, sowie aktuell bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen können der enormen Dynamik im Bereich der digitalen Transformation an verschiedenen Stellen nicht Rechnung tragen. Hier bedarf es insbesondere gezielter und aufeinander abgestimmter Maßnahmen, um agiler reagieren zu können und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Hier sind Bund, Länder, Kommunen und die Verbände gefragt.
6. Externe Unterstützung ist für den Transformationsprozess unabdingbar
Um die hohen Qualitätsstandards der Suchthilfeangebote auch bei den digitalen Angeboten beizubehalten, benötigen die Suchthilfeträger bei der Realisierung der neuen Angebote externe Unterstützung:
- juristisch, z. B. bei Fragen der Datensicherheit und Haftung
- technisch, z. B. bei der Frage, wie eine sichere Datenkommunikation gewährleistet werden kann
- ethisch, z. B. bei der Überlegung, welche Angebote digital umgesetzt werden können
- finanziell, z. B. für die Entwicklung digitaler Angebote, die Anschaffung und Pflege entsprechender IT-Infrastruktur
- organisationsbezogen, z. B. für die Umstrukturierung von Arbeitsprozessen und für Möglichkeiten bzw. Maßnahmen zur Erweiterung der Kompetenzprofile der Mitarbeiterschaft
- politisch, z. B. bei der Anpassung von gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von Förderbedingungen, um agile Arbeitsweisen und Entscheidungsprozesse zu unterstützen
- wissenschaftlich, z. B. zur wissenschaftlichen Bewertung und Evaluation digitaler Angebote
- personell, z. B. für eine enge Kooperation von Lehre und Forschung für die Fort- und Weiterbildung.
7. Gemeinsam handeln – ein Gewinn für alle
Die Bewältigung der digitalen Transformation erfordert enorme personelle und finanzielle Ressourcen. Einzelne – kleine wie auch große – Einrichtungen sind damit personell und finanziell überfordert. Träger-, verbands- und/oder länderübergreifendes Handeln ist deshalb unumgänglich.
8. Strategien schonen Ressourcen und geben Orientierung
Eine übergreifende Strategie sollte die verschiedenen Handlungsebenen berücksichtigen, jeweils darauf aufbauende Maßnahmen beschreiben und Ideen für die Umsetzung möglichst verbindlich vereinbaren. Angesichts der ausdifferenzierten Suchthilfestrukturen sind verschiedene Akteure*innen (z. B. Leistungsträger, Leistungserbringer, Klient*innen, Verwaltung und Politik) bei der Strategieentwicklung zu beteiligen.
9. Vorhandene digitale Angebote analysieren und die Ergebnisse für die weitere Entwicklung nutzen
Ausgehend von den bereits vorhandenen digitalen Angeboten in der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe gilt es abzuleiten, wo Bedarfe für den weiteren Ausbau bestehen und welche Priorisierung hier vorgenommen werden soll.
Ausblick
Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe haben sich darauf verständigt das Thema anhand der formulierten Leitgedanken weiter zu bearbeiten. Die Ergebnisse werden Verbänden, Trägern und Verwaltungen zur Verfügung gestellt. Anregungen für den weiteren Entwicklungsprozess sind willkommen. In einem nächsten Schritt sollen auf Grundlage der Diskussionsergebnisse zu dem Papier in den unterschiedlichen Gremien und einer Ist-Analyse bereits vorhandener Angebote konkrete Umsetzungsschritte diskutiert und angegangen werden.
Teilnehmer*innen und Referent*innen des Fachgesprächs
Teilnehmer*innen
Bobersky, Andrea, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
Böhl, Hans, Jugendberatung Jugendhilfe e.V. , Frankfurt/M
Egartner, Eva, Condrobs e.V., München
Goecke, Michaela, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Hardeling, Andrea, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesstellen für Suchtfragen (BAGLS)
Hellge-Antoni, Dietrich, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg
Kirschbaum, Gaby, Bundesministerium für Gesundheit
Klein, Thomas, Fachverband Sucht e.V.
Köhler-Azara, Christine, Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Berlin
Kunze, Bianca, jhj Hamburg e.V.
Lohmann, Katrin, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Lörcher-Straßburg, Bärbel, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Neugebauer, Friederike, Fachverband Drogen und Suchthilfe e.V.
Pauly, Jürgen, Bundesministerium für Gesundheit
Raiser, Peter, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Geschäftsstelle)
Reinhard, Kirsten, Arbeitsstab der Bundesdrogenbeauftragten
Rosengarten, Wolfgang, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Ruf, Daniela, Deutscher Caritasverband Freiburg für den Vorstand der DHS
Schmitt, Susanne, Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS)
Schulte-Derne, Frank, Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe und Suchtprävention e.V. (DG-SAS) für den Vorstand der DHS
Stachwitz, Philipp , health innovation hub des Bundesministeriums für Gesundheit
Referent*innen
Depew, Sabine, Diözesan-Caritasdirektorin, Essen
Wolf, Prof. Dr. Dietmar, Hochschule Hof, Fachverband Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung
Epe, Hendrik, IdeeQuadrat Freiburg, Beratungsagentur für Soziale Organisationen
Leuschner, Fabian, delphi Gesellschaft für Forschung, Beratung und Projektentwicklung mbH, Berlin
Barnikel, Dr. Norbert, Barnikel Innovation & Digital Transformation, Nürnberg