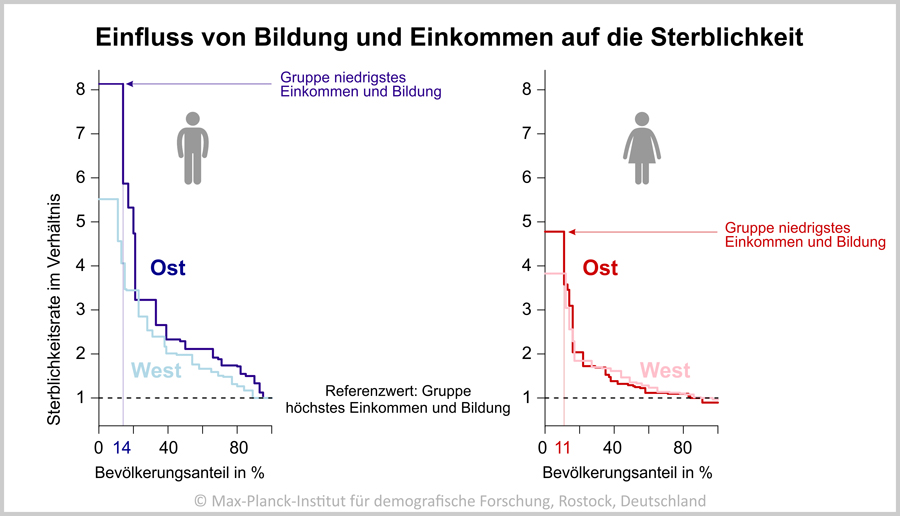Die Deutsche Herzstiftung warnt vor lebensgefährlichen Herzschäden durch den Konsum von Amphetaminen. Häufig sind Menschen unter 30 Jahren betroffen. Meist am Wochenende werden die jungen Patienten mit schwerster Luftnot in die Notfallambulanz eingeliefert. Ihr Blutkreislauf ist derart instabil, dass sie künstlich beatmet und massiv medikamentös behandelt werden müssen. Die Ursache für die schwere Funktionsstörung ihres Herzens: feine Narben durchziehen den Herzmuskel und verdrängen funktionstüchtige Herzmuskelanteile. Deshalb arbeitet die linke Herzkammer nur noch schwach. Die toxikologische Untersuchung der Patienten ergibt eine hohe Amphetamindosis. Herzspezialisten in Deutschlands Kliniken bemerken einen Zuwachs an derartigen Notfällen. Meist sind es junge Patienten um die 20 bis 25 Jahre. Allein 2012 waren es bundesweit 36 dieser Art.
„Wir haben in unserer Klinik seither immer wieder Fälle mit schweren, durch Amphetamine ausgelöste Herzschäden behandelt“, bestätigt Prof. Dr. med. Heinrich Klues, Chefarzt der Medizinischen Klinik I für Kardiologie und konservative Intensivmedizin am Helios Klinikum Krefeld. „Bei allen Patienten fanden wir vergleichbare Schadensmuster, vorrangig eine hochgradig eingeschränkte Pumpleistung der linken Herzkammer“, berichtet Klues, der auch im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung (www.herzstiftung.de) sitzt, in einem Artikel über die medizinischen Hintergründe und verheerenden Folgen von Lifestyle-Drogen für Herz und Kreislauf. Dazu zählen beschleunigtes Verengen der Herzkranzgefäße (Arteriosklerose), Herzschwäche und gefährliche Rhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod. Sein Titelbeitrag „Von der Technoparty auf die Intensivstation – Die gefährlichen Lifestyle-Drogen“ erscheint in Ausgabe 4/2019 der Herzstiftungs-Zeitschrift HERZ heute. Der Artikel sensibilisiert zudem das Umfeld der Betroffenen für das Thema und gibt Rat, wohin sich Familien und Schulen wenden können. Die Ausgabe 4/2019 von HERZ heute kann kostenfrei bei der Herzstiftung unter Tel. 069/95 51 28 400 oder unter bestellung@herzstiftung.de angefordert werden.
Amphetamine wirken wie künstlich erzeugter Stress
Amphetamine ähneln in ihrem chemischen Aufbau körpereigenen Botenstoffen (Neurotransmitter) und veranlassen eine unkontrollierte und ungehemmte Ausschüttung dieser Neurotransmitter. Die Folge ist ein Feuerwerk an Nervenimpulsen im Gehirn, was der Körper als künstlich erzeugten Stress erlebt. Darin wirken Amphetamine aufputschend und leistungssteigernd. Mediziner vermuten in dem dauerhaft erzeugten Stresszustand auch die eigentliche Ursache für die Vernarbungen im Herzmuskelgewebe der Betroffenen. „Die Wirkung der Amphetamine ist auch deshalb bei jungen Erwachsenen so zerstörerisch, weil sie medizinisch zumeist erst dann auffällig werden, wenn ihr Herz bereits lebensbedrohlich geschädigt ist“, so Klues. Bei seinen Patienten bestand oftmals Unwissenheit über die Inhaltsstoffe, die Dosis oder mögliche Beimengungen der „Partydroge“. Als weiteren Gefahrenaspekt nennt der Krefelder Kardiologe, dass Arztbesuche von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eher selten sind – dadurch wird die Chance einer frühen Diagnose verpasst; Angehörige dieser Altersgruppe verfügen über große Leistungsreserven und zeigen erst spät Symptome; erste Anzeichen werden häufig nicht beachtet oder fehlgedeutet. Zudem zählten Fragen nach dem Drogenkonsum oder das Veranlassen von Drogentests nicht zu den Standards in Praxen und Krankenhäusern. Das dürfte auch daran liegen, dass sich bis 2010 in der internationalen Fachliteratur kaum Hinweise auf eine direkte Schädigung des Herzens durch Amphetamine fanden.
Wachsendem Trend zu Amphetaminen mehr Aufmerksamkeit schenken
Nach europäischen und US-amerikanischen Statistiken werden Amphetamine vor allem von jungen Männern und Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren konsumiert. Auch jüngere Konsumenten ab dem zwölften Lebensjahr sind beschrieben. Weltweit gibt es laut „United Nations Drug Report 2017“ über 37 Millionen Abhängige, die regelmäßig Amphetamine, vor allem Methamphetamin, einnehmen. Experten wie der Klinikarzt Klues sehen es als „sehr wahrscheinlich, dass die Anzahl der Menschen, die aufgrund ihres Amphetaminkonsums eine schwere Herzschädigung erleiden, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa stark zunehmen wird“. Vor diesem Hintergrund mahnt die Deutsche Herzstiftung zu mehr Aufmerksamkeit für die Folgen des regelmäßigen Amphetaminkonsums auf Herz und Gefäße, aber auch auf das Nervensystem sowie andere Organe wie Gehirn, Leber und Nieren. „Größere Sensibilität im familiären Umfeld und in den Schulen der Jugendlichen, aber auch bei den Ärzten in Praxen und Kliniken ist erforderlich“, meint Klues. Für Betroffene gibt es neben Selbsthilfegruppen professionelle Suchtberatungsstellen (Adressen z.B. im Verzeichnis der BZgA), die bundesweite „Sucht & Drogen Hotline“ und nicht zuletzt die Telefonseelsorge.
Hintergrund zu Amphetaminen
In ihrem chemischen Aufbau ähneln Amphetamine körpereigenen Botenstoffen (Neurotransmitter). Die natürlichen Botenstoffe veranlassen an Synapsen – den chemischen Kontaktstellen zwischen Nervenzellen –, dass die elektrische Erregung von einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle übertragen wird. Amphetamine verdrängen die natürlichen Boten aus ihren Reservoirs in den Nervenzellen. Infolgedessen werden Neurotransmitter unkontrolliert und ungehemmt ausgeschüttet: Unabhängig davon, ob eine Nervenzelle „feuert“ oder nicht, gelangen die Botenstoffe in den Spalt zwischen zwei Nervenzellen. Auf diese Weise veranlassen Amphetamine ein regelrechtes Feuerwerk an Nervenimpulsen im Gehirn. Die natürlichen Mechanismen der Erregungsweiterleitung werden außer Kraft gesetzt. Es kommt zu einem massiven, künstlich erzeugten Stress. Im Stressmodus sind alle unsere Sinne aufs Äußerste geschärft, wir empfinden keine Müdigkeit, keinen Hunger und Durst, die Luftwege erweitern sich, das Atmen fällt leichter, selbst das Schmerzempfinden ist reduziert. Herzfrequenz und Blutdruck steigen rapide an.
Originalpublikation:
Klues, H., „Von der Technoparty auf die Intensivstation – Die gefährlichen Lifestyle-Drogen“, in: Deutsche Herzstiftung (Hg.), HERZ heute, Ausg. 4/2019, Frankfurt a. M. 2019.
Pressestelle der Deutschen Herzstiftung e.V./Deutsche Stiftung für Herzforschung, 25.11.2019