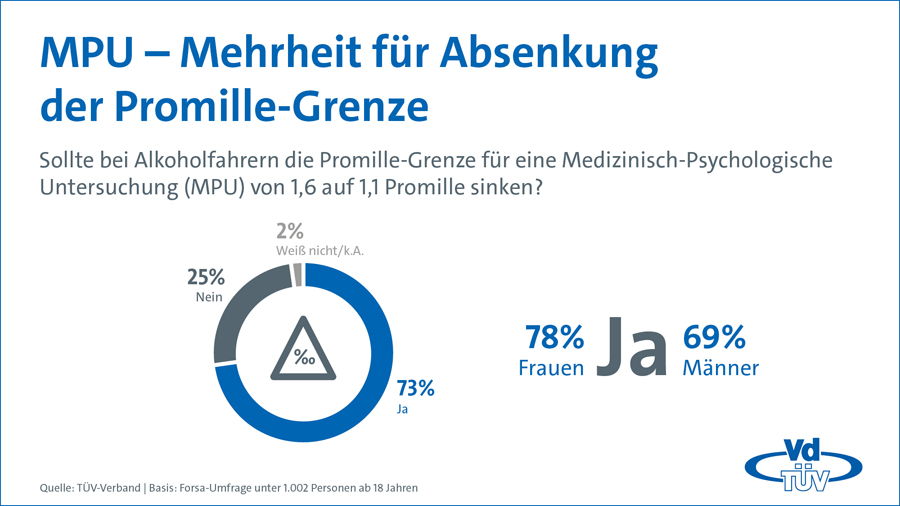Stellungnahme der AG MedReha:
Grundsätzliche Anforderungen an ein Rehabewertungs- und Steuerungssystem im Bereich der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung aus Sicht der Verbände der Leistungserbringer
 Vom Grundsatz her befürworten die Verbände der Leistungserbringer die Weiterentwicklung einer qualitätsorientierten Steuerung und Belegung im Bereich der medizinischen Rehabilitation durch die Rentenversicherungsträger. Diese sollte alle Rehabilitationseinrichtungen gleich welcher Trägerschaft betreffen. Grundlage dafür ist, dass verlässliche und ausreichende Beurteilungsgrundlagen über die Qualität von miteinander vergleichbaren Rehabilitationseinrichtungen vorliegen. Hierbei sind die verschiedenen Dimensionen der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu berücksichtigen, wobei perspektivisch der Ergebnisqualität eine wesentlichere Bedeutung zugeteilt werden sollte. Anforderungen an ein Reha-Bewertungssystem werden aus Sicht der Leistungserbringer im Weiteren beschrieben.
Vom Grundsatz her befürworten die Verbände der Leistungserbringer die Weiterentwicklung einer qualitätsorientierten Steuerung und Belegung im Bereich der medizinischen Rehabilitation durch die Rentenversicherungsträger. Diese sollte alle Rehabilitationseinrichtungen gleich welcher Trägerschaft betreffen. Grundlage dafür ist, dass verlässliche und ausreichende Beurteilungsgrundlagen über die Qualität von miteinander vergleichbaren Rehabilitationseinrichtungen vorliegen. Hierbei sind die verschiedenen Dimensionen der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu berücksichtigen, wobei perspektivisch der Ergebnisqualität eine wesentlichere Bedeutung zugeteilt werden sollte. Anforderungen an ein Reha-Bewertungssystem werden aus Sicht der Leistungserbringer im Weiteren beschrieben.
1. Repräsentativität des Verfahrens
Die Rentenversicherungsträger müssen dafür Sorge tragen, dass alle von ihnen federgeführten Rehabilitationseinrichtungen am Reha-Bewertungssystem teilnehmen und sich (möglichst) alle Rehabilitationseinrichtungen in allen Qualitätsdimensionen im Rahmen der externen Qualitätssicherung abbilden lassen. Dies ist derzeit noch nicht in allen Indikationsbereichen gewährleistet. Voraussetzung für die Abschätzung der Repräsentativität des Verfahrens ist es, die indikationsspezifischen Grundgesamtheiten der Fachkliniken/Abteilungen zu kennen und diese auch in den jeweiligen Qualitätsberichten von den Herausgebern anzugeben. Es stellt keine praktikable Lösung dar, eine Rehabilitationseinrichtung bei fehlenden Werten zu einer spezifischen Qualitätsdimension auf den Durchschnittswert zu stellen, zumal derzeit lediglich fünf Qualitätsdimensionen erfasst werden (Patientenzufriedenheit, subjektiver Behandlungserfolg, Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL), Reha-Therapiestandards [nur bei einzelnen Indikationen], Peer-Review-Verfahren). Mit einer zu geringen Abbildung einer Einrichtung in den verschiedenen Qualitätsdimensionen fehlt für diese eine entsprechende Grundlage für qualitätsorientierte Einrichtungsvergleiche. Zudem kann eine entsprechende Einrichtung dann auch keine zusätzlichen Konsistenzpunkte erreichen. Von daher sind die Realisierung sowohl der technischen Voraussetzungen innerhalb der Rentensicherung zur elektronischen Datenübermittlung wie auch die Ausweitung der Datenbasis für Einrichtungen, die derzeit nur ungenügend mittels des QS Verfahrens abgebildet werden, von zentraler Bedeutung für die Erweiterung der Vergleichsbasis.
Von daher ist auch die Repräsentativität der einrichtungsbezogenen Stichproben bei der Patientenbefragung zu gewährleisten. So sind Mindestquoten für die erforderlichen Rückläufe einer Einrichtung bei der Patientenbefragung festzulegen, auf deren Basis dann aussagefähige Schlüsse gezogen werden können.
2. Bildung von Vergleichsgruppen (auf Einrichtungs- und Patientenebene)
Die Bildung gerechter Vergleiche von Einrichtungen erfordert, dass diese sich hinsichtlich der Einrichtungsmerkmale und der behandelten Patientengruppen nicht bzw. nur geringfügig voneinander unterscheiden dürfen. Von daher wäre die Bildung von Fachabteilungsschlüsseln für möglichst homogene Patientengruppen eine wesentliche Voraussetzung dafür, gerechte Vergleiche ziehen zu können. Hierbei sind auch die ICD-Haupt- und Nebendiagnosen zu beachten sowie die spezifischen Teilhabebedarfe der jeweiligen Patienten. Beispielsweise befinden sich in den Abteilungen der Inneren Medizin oder auch der Psychosomatik heterogene Patientenklientel, die einer differenzierten Betrachtung hinsichtlich der Definition von Qualitätsparametern und der Beurteilung eines Rehabilitationserfolges bedürfen. Bei der Bildung möglichst differenzierter Vergleichsgruppen ist dabei immer auch die Anzahl der in den jeweiligen Vergleichsgruppen befindlichen Fachabteilungen im Blick zu behalten, um eine ausreichende Datengrundlage gewährleisten zu können.
Wir begrüßen es, dass eine Risikoadjustierung bereits bei der Patientenbefragung erfolgt und die entsprechende Methodik derzeit überprüft und angepasst wird. Wir schlagen zudem vor, – sofern erforderlich – auch die Qualitätsvorgaben hinsichtlich spezifischer Bedarfe von Patientengruppen zu spezifizieren (z.B. erforderliche Anzahl und Inhalte von Leistungen für rehabilitationsbedürftige Mütter mit Kindern in der Rehabilitationseinrichtung bei KTL).
3. Visitationen und Transparenz der Ergebnisse
Visitationen spielen im Kontext des QS-Programms der Rentenversicherung eine sehr zentrale Rolle, denn diese finden vor Ort in der Rehabilitationseinrichtung statt und bieten damit die Möglichkeit, sich ein realistisches Bild der Rehabilitationseinrichtung zu verschaffen und Ergebnisse des QS- Programms sowie weitere qualitätsrelevante Aspekte zu besprechen.
Sicherzustellen ist, dass erfolgte Nachbesserungen nach einer durchgeführten Visitation oder einem strukturierten Qualitätsdialog in die entsprechenden Datenbanken der Leistungsträger direkt eingepflegt werden. Die zuweisungsrelevante Datenlage muss immer auf dem aktuellen Stand sein, eventuelle Nachbesserungen müssen zeitnah berücksichtigt werden. Zudem müssen aus Sicht der Leistungserbringer unter dem Aspekt der Transparenz die dokumentierten und in den entsprechenden Datenbanken hinterlegten Visitationsergebnisse und alle weiteren Daten den Einrichtungen voll vollumfänglich zugänglich gemacht werden.
4. Aktualität der QS-Ergebnisse
Erforderlich ist die Gewährleistung einer möglichst hohen Aktualität der QS-Ergebnisse der Rentenversicherung in allen Qualitätsdimensionen. Aus Sicht der Verbände der Leistungserbringer sollten die entsprechenden QS-Daten mindestens jährlich erhoben werden, um eine Festschreibung einer Rehabilitationseinrichtung auf bereits veraltete Werte nach Möglichkeit zu verhindern.
5. Validität der Qualitätsergebnisse
Es ist zu gewährleisten, dass die von der DRV erhobenen Qualitätsergebnisse valide sind. Im Falle erforderlicher Korrekturen auf Basis plausibler Rückmeldungen einer Rehabilitationseinrichtung ist sicherzustellen, dass die in den Datenbanken der Leistungsträger dokumentierten QS-Ergebnisse auch unmittelbar entsprechend verändert werden.
6. Erweiterung der Qualitätsdimensionen
Erforderlich ist aus Sicht der Verbände der Leistungserbringer, dass die Qualitätsdimensionen im Rahmen des QS-Programms der Rentenversicherung erweitert werden, zumal zu erwarten ist, dass bei verschiedenen derzeitigen Qualitätsdimensionen (KTL, RTS) zukünftig „Deckeneffekte“ eintreten werden. Dies bedeutet, dass hier mit einer Nivellierung der Unterschiede in naher Zukunft zu rechnen sein wird.
Die Dimension „Ergebnisqualität“ wird derzeit nur rudimentär im QS Programm abgebildet. Vorgeschlagen wird im Rahmen der zukünftigen Weiterentwicklung ein zusätzliches indikationsbezogenes QS- Instrument für diese Qualitätsdimension zu schaffen, mit dem sich nicht nur Unterschiede zu Beginn und am Ende der medizinischen Rehabilitationsleistung, sondern auch der längerfristige Behandlungserfolg erfassen und abbilden lassen. Bei der Erfolgsmessung ist zudem eine spezifische Risikoadjustierung erforderlich.
7. Personelle Ressourcen und Einbezug der Verbände der Leistungserbringer
Die Weiterentwicklung und Umsetzung des QS-Programms erfordert gerade auch vor dem Hintergrund, dass Qualität steuerungsrelevant sein soll, erhebliche personelle und strukturelle Ressourcen – auch auf Seiten der Leistungsträger. Zudem sollte die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten Steuerungs- und Bewertungssystems in gemeinsamer Kooperation der Rentenversicherungsträger mit den Verbänden der Leistungserbringer auf Augenhöhe erfolgen. Die Vertreter der Leistungserbringer sollten als Reha-Experten dabei unbedingt von Beginn an einbezogen und auch an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
Quelle: AG MedReha, 24.01.2019