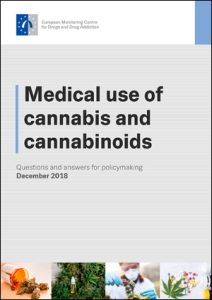97 Prozent aller starken Raucher schaffen die Entwöhnung nicht ohne professionelle Hilfe. Eine Studie am Universitätsklinikum Freiburg prüft nun, ob sechs Wochen ambulante oder neun Tage stationäre Entwöhnung wirksamer sind.
Der dauerhafte Verzicht auf die Zigarette ist für viele Raucherinnen und Raucher ein schwieriger Prozess, der meist mehrerer Anläufe und professioneller Hilfe bedarf. Nun überprüfen Ärzte und Wissenschaftler am Tumorzentrum Freiburg – CCCF des Universitätsklinikums Freiburg in einer Studie, ob eine sechswöchige ambulante Entwöhnung oder eine neuntägige stationäre Entwöhnung erfolgreicher ist. Für die von der Deutschen Krebshilfe geförderte Studie werden insgesamt 274 Probanden gesucht. Die ambulante Entwöhnung kann bundesweit wohnortnah bei einem zertifizierten Entwöhnungstherapeuten durchgeführt werden. Die stationäre Raucherentwöhnung erfolgt in der Breisgauklinik in Bad Krozingen. Im Rahmen der Studie wird ein Großteil der Kosten für beide Therapieformen übernommen.
„Ohne professionelle Hilfe liegt das Rückfallrisiko starker Raucher bei 97 Prozent“, warnt der Onkologe Dr. Jens Leifert, der die Studie leitet. Ambulante Therapien sind seit langem sehr gut etabliert. Sie bestehen meist aus ein- bis zweistündigen Gruppentherapiestunden über sechs bis acht Wochen. In den letzten Jahren hat aber auch die stationäre Therapie, vor allem in den USA, sehr gute Erfolge gezeigt. Durch die Studie soll nun untersucht werden, welche der beiden Therapieformen insgesamt wirksamer ist oder ob für bestimmte Personen eine der beiden Therapieformen besser angepasst ist. Sowohl die ambulante als auch die stationäre Raucherentwöhnungstherapie im Rahmen der Studie wird auf Basis aktueller Leitlinien und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse durchgeführt. Die Zuteilung zu einer der beiden Gruppen erfolgt zufällig per Losverfahren.
Die Studie richtet sich an volljährige Personen, die mindestens zehn Zigaretten täglich rauchen. Die Kosten für die stationäre Therapie, inklusive Unterbringung mit Vollpension, sowie An- und Abreise werden übernommen. Es fällt lediglich eine Eigenbeteiligung in Höhe von 50 Euro an. Auch die Therapiekosten für die ambulante Entwöhnung werden unterstützt, sodass – je nach Therapeutenwahl – ein ähnlicher hoher Eigenbetrag verbleibt. Nicht teilnehmen dürfen Personen mit erhöhtem Alkohol- oder sonstigem Drogenkonsum, Schwangere sowie Personen mit psychischen beziehungsweise anderen schweren medizinischen Erkrankungen.
Kontakt:
Christina Lorz, Christina Schulz
Psychologinnen im Präventionsteam, Tumorzentrum Freiburg-CCCF
cpmt@uniklinik-freiburg.de
Weitere Informationen zur Studie:
https://www.uniklinik-freiburg.de/cccf/patienten/praevention/raucherpraevention/studie-raucherentwoehnung.html
Pressestelle des Universitätsklinikums Freiburg, 24.01.2019