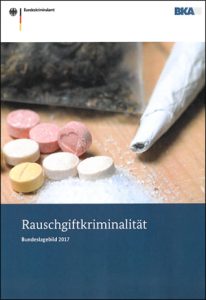Der am 7. Juni 2018 in Brüssel vorgestellte Europäische Drogenbericht 2018: Trends und Entwicklungen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) zeigt, dass die Verfügbarkeit von Kokain zugenommen hat. Hintergrund dieser Entwicklung ist ein dynamischer Drogenmarkt, der in der Lage ist, sich rasch auf Maßnahmen zur Drogenbekämpfung einzustellen. Die Agentur untersucht in ihrem jährlichen Überblick zudem, welche Herausforderungen Neue psychoaktive Substanzen (NPS) und die Verfügbarkeit neuer synthetischer Opioide (insbesondere hochpotenter Fentanyl-Derivate) sowie der Konsum synthetischer Cannabinoide in marginalisierten Bevölkerungsgruppen (unter anderem bei Gefängnisinsassen) mit sich bringen. Die im Bericht vorgelegten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016 bzw. das jeweils letzte Jahr, für das Daten verfügbar sind. Außerdem erschienen sind 30 Länderberichte (in englischer Sprache) mit den jüngsten Analysen zur Drogensituation in den einzelnen Ländern.
Der am 7. Juni 2018 in Brüssel vorgestellte Europäische Drogenbericht 2018: Trends und Entwicklungen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) zeigt, dass die Verfügbarkeit von Kokain zugenommen hat. Hintergrund dieser Entwicklung ist ein dynamischer Drogenmarkt, der in der Lage ist, sich rasch auf Maßnahmen zur Drogenbekämpfung einzustellen. Die Agentur untersucht in ihrem jährlichen Überblick zudem, welche Herausforderungen Neue psychoaktive Substanzen (NPS) und die Verfügbarkeit neuer synthetischer Opioide (insbesondere hochpotenter Fentanyl-Derivate) sowie der Konsum synthetischer Cannabinoide in marginalisierten Bevölkerungsgruppen (unter anderem bei Gefängnisinsassen) mit sich bringen. Die im Bericht vorgelegten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016 bzw. das jeweils letzte Jahr, für das Daten verfügbar sind. Außerdem erschienen sind 30 Länderberichte (in englischer Sprache) mit den jüngsten Analysen zur Drogensituation in den einzelnen Ländern.
Laut dem Bericht der EMCDDA ist eine durchweg hohe Verfügbarkeit von Drogen zu beobachten, die in einigen Regionen sogar anzusteigen scheint. Den jüngsten Zahlen zufolge wurden in Europa (EU-28, Türkei und Norwegen) 2016 mehr als eine Million Sicherstellungen illegaler Drogen gemeldet. Über 92 Millionen in der EU lebende Erwachsene (im Alter von 15 bis 64 Jahren) haben im Verlauf ihres Lebens schon mindestens einmal irgendeine illegale Droge konsumiert, während schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen in der EU-28 im Jahr 2016 wegen des Konsums illegaler Drogen in Behandlung waren.
Dimitris Avramopoulos, Europäischer Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, erklärt hierzu: „Es ist zu beobachten, dass in Europa derzeit mehr Drogen produziert und angeboten werden. Hinzu kommt, dass der Markt für illegale Drogen sehr dynamisch und anpassungsfähig – und daher umso gefährlicher – ist. Wenn wir nicht ins Hintertreffen geraten wollen, müssen wir uns verstärkt darum kümmern, die Widerstands- und Reaktionsfähigkeit zu erhöhen, nicht zuletzt wegen der zunehmenden Bedeutung von Online-Marktplätzen und der Entwicklung neuer Drogenarten. Bis zum Jahresende werden neue Vorschriften hinsichtlich neuer psychoaktiver Substanzen in Kraft treten, die Europa zusätzliche, gute Instrumente an die Hand geben werden, um die Herausforderungen wirksamer angehen zu können und den Schutz der Bürger und Bürgerinnen in Europa vor gefährlichen Drogen zu erhöhen.“
Kokain: Erhöhte Verfügbarkeit und höchster Reinheitsgrad seit zehn Jahren
Kokain ist das am häufigsten konsumierte illegale Stimulans in Europa. Etwa 2,3 Millionen junge Erwachsene (zwischen 15 und 34 Jahren) haben diese Droge in den vergangenen zwölf Monaten konsumiert (EU-28). Die aktuelle Analyse zeigt, dass angesichts der Hinweise auf einen steigenden Koka-Anbau und eine erhöhte Kokainproduktion in Lateinamerika der Kokainmarkt in Europa floriert. Einige Indikatoren deuten gegenwärtig darauf hin, dass die Verfügbarkeit der Droge in einer Reihe von Ländern angestiegen ist. Obwohl der Kokainpreis stabil geblieben ist, erreichte die Reinheit der Droge 2016 im Straßenverkauf den höchsten Grad seit zehn Jahren. Auch die Zahl der Beschlagnahmungen von Kokain hat zugenommen. In der EU wurden 2016 rund 98 000 Sicherstellungen der Droge gemeldet (2015 waren es 90 000). Insgesamt wurden 70,9 Tonnen beschlagnahmt).
Auf städtischer Ebene zeigte eine kürzlich durchgeführte Untersuchung, dass die Kokainrückstände im Abwasser von 26 der 31 Städte, zu denen Daten für diesen Zeitraum vorliegen, zwischen 2015 und 2017 angestiegen sind. Die meisten Rückstände wurden in Städten in Belgien, den Niederlanden, Spanien und im Vereinigten Königreich verzeichnet, während in den untersuchten osteuropäischen Städten niedrige Werte gemessen wurden.
Der Bericht zeigt auch, dass die Zahl der lebenszeitbezogenen Erstbehandlungen im Zusammenhang mit Kokain zugenommen hat. Im Jahr 2016 begaben sich 30 300 Personen aufgrund von Problemen mit dieser Droge erstmals in Behandlung – über ein Fünftel mehr als 2014. Insgesamt unterzogen sich 2016 mehr als 67 000 Personen einer auf Kokainprobleme zugeschnittenen Spezialbehandlung. Besonders besorgniserregend sind die schätzungsweise 8 300 Personen, die sich 2016 wegen des primären Konsums von Crack in Behandlung begaben. Zudem war Kokain 2016 die zweithäufigste Droge, die bei drogenbedingten Notfällen in den Krankenhäusern des 19 Beobachtungsklinken umfassenden Euro-DEN-Netzes nachgewiesen wurde (Euro-DEN Plus).
Auch die Schmuggelmethoden und Schmuggelrouten scheinen sich zu ändern. Die Iberische Halbinsel – bislang Haupteinfuhrort für Kokain, das auf dem Seeweg nach Europa gelangt – ist in dieser Hinsicht zwar weiterhin von Bedeutung, steht den Daten von 2016 zufolge jedoch nicht mehr unangefochten an erster Stelle, da auch von den Containerhäfen weiter nördlich große Sicherstellungen gemeldet wurden. 2016 wurden in Belgien 30 Tonnen Kokain sichergestellt (43 % der geschätzten jährlichen Gesamtmenge des in der EU beschlagnahmten Kokains).
Anzeichen für eine gestiegene Drogenproduktion innerhalb Europas
Europa ist ein wichtiger Markt für illegale Drogen, die aus verschiedenen Teilen der Welt, etwa aus Lateinamerika, Westasien und Nordafrika eingeschleust werden. In dem Bericht wird jedoch auch auf die Rolle Europas als Ort der Herstellung von Drogen hingewiesen: Bei einer Vielzahl von Substanzen waren im Berichtsjahr besorgniserregende Anzeichen dafür zu beobachten, dass die Herstellung von Drogen in Europa zunimmt.
Die Produktion findet aus mehreren Gründen näher an den Verbrauchermärkten statt, etwa aus praktischen Erwägungen heraus, wegen des geringeren Risikos, an der Grenze entdeckt zu werden, und weil die Grundsubstanzen für die Produktion je nach Droge verfügbar und kostengünstig sind. Der Bericht führt mehrere Beispiele für eine höhere Drogenproduktion in Europa und für innovative Produktionsmethoden auf. Dazu zählen Hinweise auf illegale Labore, die Kokain verarbeiten, die zahlenmäßige Zunahme entdeckter MDMA- bzw. Ecstasy-Labore, die Ausweitung der Methamphetamin- produktion unter höherer Beteiligung organisierter Banden, die Produktion von Amphetaminen in der Endphase im Land des Konsums sowie die Entdeckung einer geringen Zahl an Laboren zur Herstellung von Heroin. Einige der in der EU hergestellten synthetischen Drogen sind für Auslandsmärkte, etwa für den amerikanischen Kontinent, Australien, Nah- und Fernost sowie die Türkei, bestimmt.
Die vermehrte Produktion von hochpotentem Cannabis innerhalb Europas hat offenbar auch Auswirkungen auf die Aktivitäten von Cannabisproduzenten außerhalb der EU, was sich daran ablesen lässt, dass Cannabisharz mit höherem Wirkstoffgehalt aus Marokko nach Europa geschmuggelt wird. Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass neue psychoaktive Substanzen, die gewöhnlich in China hergestellt und zur Verpackung nach Europa geliefert werden, bisweilen auch innerhalb Europas produziert werden.
Cannabis: Verfügbarkeit und Konsum sind weiterhin hoch
Cannabis ist auch weiterhin die am meisten konsumierte illegale Droge in Europa. Dies zeigen die Daten zur Prävalenz, zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, zu Sicherstellungen und zum gestiegenen Behandlungsbedarf. Etwa 17,2 Millionen junge Europäer (zwischen 15 und 34 Jahren) haben in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert (EU-28), und rund ein Prozent aller erwachsenen Europäer (zwischen 15 und 64 Jahren) verwenden die Droge täglich oder fast täglich (EU-28).
Cannabis war bei mehr als drei Viertel (77 Prozent) aller 2016 in der EU gemeldeten 800 000 Verstöße gegen die Vorschriften über den Drogenbesitz oder -konsum, bei denen die Primärdroge bekannt ist, beteiligt. Zudem ist Cannabis die am häufigsten beschlagnahmte Droge: Im Jahr 2016 wurden in der EU 763 000 Sicherstellungen von Cannabisprodukten gemeldet. Der größte Anteil (45 Prozent) von Erstbehandlungen aufgrund von Drogenproblemen in Europa (EU-28, Türkei und Norwegen) geht auf den Konsum von Cannabis zurück. Die Zahl der Erstpatienten, die sich wegen Cannabisproblemen behandeln ließen, stieg in den 25 Ländern, für die Daten zu beiden Jahren vorliegen, von 43 000 im Jahr 2006 auf 75 000 im Jahr 2016.
Kürzlich vorgenommene gesetzliche Änderungen in Bezug auf Cannabis in Teilen Amerikas, etwa die Legalisierung in einigen Ländern, haben dazu geführt, dass sich dort schnell ein kommerzieller Cannabismarkt für den Freizeitkonsum entwickelt hat. Dies führt derzeit zu Innovationen bei den Abgabesystemen und bei der Entwicklung von Cannabisprodukten (z. B. E-Liquids, essbare Produkte und hochpotente Stämme).
Noch ist unklar, welche Folgen es für Europa haben wird, wenn in Teilen Amerikas ein großer legaler Markt für diese Droge entsteht, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dies auf die Angebots- oder Konsummuster in Europa auswirken wird. Die EMCDDA beobachtet die internationalen Entwicklungen im Bereich der Cannabis-Regulierung aufmerksam, um die sich vollziehenden Änderungen erfassen und verständlich darstellen zu können und mögliche Auswirkungen auf die Situation in Europa zu ermitteln. Ein Bereich, der infolge der sich weltweit ändernden Einstellungen zur Cannabis-Regulierung größere politische Aufmerksamkeit erhält, ist der Cannabiskonsum in Verbindung mit dem Fahren unter Drogeneinfluss. Dieses Thema steht im Mittelpunkt eines kürzlich veröffentlichten EMCDDA-Berichts, der sich auf die Erkenntnisse internationaler Experten stützt.
Geringere Zahl neuer psychoaktiver Substanzen, aber mehr Hinweise auf Schädigungen
Neue psychoaktive Substanzen (NPS/„neue Drogen“) stellen in Europa nach wie vor ein gravierendes Problem für die Politik und die öffentliche Gesundheit dar. Diese Substanzen, die nicht vom internationalen Drogenkontrollsystem erfasst werden, umfassen ein breites Spektrum, zu dem synthetische Cannabinoide, Opioide, Cathinone und Benzodiazepine gehören. Im Jahr 2017 wurden 51 neue psychoaktive Substanzen erstmals in das EU-Frühwarnsystem aufgenommen, dies entspricht einer Quote von etwa einer Substanz pro Woche. Auch wenn die jährliche Gesamtzahl neu auf dem Markt erscheinender Substanzen die der Spitzenjahre unterschreitet – 2015: 98, 2014: 101 –, ist die Zahl der verfügbaren neuen psychoaktiven Substanzen insgesamt weiterhin hoch. Ende 2017 überwachte die EMCDDA mehr als 670 neue psychoaktive Substanzen (gegenüber etwa 350 im Jahr 2013). Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit neuen synthetischen Cannabinoiden und neuen synthetischen Opioiden, darunter akute Vergiftungen und Todesfälle, veranlassten die EMCDDA dazu, 2017 insgesamt neun Risikobewertungen durchzuführen, so viele wie noch nie davor.
Die größte von der EMCDDA beobachtete Gruppe chemischer Stoffe sind neue synthetische Cannabinoide, von denen seit 2008 179 nachgewiesen wurden (10 davon im Jahr 2017). Die häufig als „Kräutermischungen“ verkauften synthetischen Cannabinoide waren 2016 mit knapp über 32 000 gemeldeten Beschlagnahmungen (gegenüber 10 000 im Jahr 2015) die am häufigsten sichergestellten neuen psychoaktiven Drogen. Damit machten sie fast die Hälfte aller beschlagnahmten neuen psychoaktiven Substanzen aus, die der Agentur 2016 gemeldet wurden. Vier synthetische Cannabinoide wurden 2017 einer Risikobewertung unterzogen: AB-CHMINACA, ADB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA und CUMYL-4CN-BINACA.
Es werden zunehmend mehr hochpotente neue synthetische Opioide (insbesondere Fentanyl-Derivate) entdeckt, die die Wirkung natürlich gewonnener Opiate (wie Heroin und Morphin) imitieren. Gelegentlich sind sie in neuartiger Form erhältlich (z. B. als Nasensprays), oder sie werden mit illegalen Drogen wie Heroin oder Kokain gemischt oder als solche verkauft. Seit 2009 wurden insgesamt 38 neue synthetische Opioide auf den europäischen Drogenmärkten nachgewiesen (13 davon im Jahr 2017). Fentanyl-Derivate, die wichtigsten Substanzen in der derzeitigen Opioidkrise in den USA, sollten in Europa weiter mit Besorgnis und Wachsamkeit verfolgt werden. Diese hochpotenten Substanzen – manche sind um ein Vielfaches potenter als Morphin – machten mehr als 70 Prozent der schätzungsweise 1 600 neuen synthetischen Opioide aus, die 2016 beschlagnahmt wurden. Im Jahr 2017 wurden zehn neue Fentanyl-Derivate über das EU-Frühwarnsystem gemeldet, fünf davon wurden einer Risikobewertung unterzogen (Acryloylfentanyl, Furanylfentanyl, 4-Fluorisobutyrylfentanyl, Tetrahydrofuranylfentanyl und Carfentanil).
Haftanstalten: Konzentration auf Gesundheitsfürsorge und neue Drogen
Haftanstalten sind relevante Settings, wenn es um die medizinische Versorgung von Drogen- konsumierenden geht. Eine gute intramurale Versorgung kann auch der Allgemeinheit zugutekommen (etwa indem Überdosierungen nach der Entlassung vermieden oder die Übertragung drogenbedingter Infektionskrankheiten wie HIV und HCV verringert werden). Der diesjährige Bericht zeigt die Interventionsmöglichkeiten in Gefängnissen und die unterschiedlichen Versorgungsleistungen in den einzelnen Ländern auf.
In einer neuen länderübergreifenden Studie, die gemeinsam mit dem heute vorgestellten Bericht veröffentlicht wird, untersucht die Agentur die zunehmenden Gesundheits- und Sicherheitsprobleme, die sich aus dem Konsum neuer psychoaktiver Substanzen in Haftanstalten ergeben. „Der Konsum neuer psychoaktiver Substanzen und die damit einhergehenden Schäden sind für das Strafvollzugs- system in Europa eine neue wichtige Herausforderung“, heißt es in der Studie. Unter den vier Haupttypen der in Haftanstalten entdeckten neuen psychoaktiven Substanzen stehen synthetische Cannabinoide an erster Stelle. Wichtige Faktoren, die ihren Konsum in Gefängnissen ermöglichen, sind die Leichtigkeit, mit der sie eingeschleust werden können (etwa in flüssiger Form auf Papier oder auf Textilien aufgesprüht), sowie die Schwierigkeit, sie in Drogentests nachzuweisen.
Verkauf im Internet und das Aufkommen neuer Benzodiazepine
Mengenmäßig wird der Verkauf von Drogen nach wie vor von traditionellen Offline-Märkten dominiert, allerdings scheint die Bedeutung von Online-Marktplätzen zuzunehmen, was die Drogenbekämpfung vor neue Herausforderungen stellt. In einer kürzlich veröffentlichten EMCDDA/Europol-Studie wurden über 100 globale Darknet-Marktplätze ermittelt, rund zwei Drittel aller Käufe auf diesen Plattformen betrafen Drogen. Auch das sichtbare Web und die sozialen Medien spielen offenbar eine immer wichtigere Rolle, vor allem beim Angebot neuer psychoaktiver Substanzen und beim Zugang zu missbräuchlich verwendeten Arzneimitteln.
In dem Bericht wird auch auf das besorgniserregende Aufkommen neuer Benzodiazepine – sowohl auf der Straße als auch im Internet – hingewiesen, die in der EU nicht als Arzneimittel zugelassen sind. Die EMCDDA überwacht derzeit 23 neue Benzodiazepine (drei davon wurden 2017 erstmals in Europa nachgewiesen). Einige werden unter ihrem Eigennamen verkauft (z. B. Diclazepam, Etizolam, Flubromazolam, Flunitrazolam, Fonazepam). In anderen Fällen werden diese Substanzen zur Herstellung von Fälschungen häufig verschriebener Benzodiazepine (z. B. Diazepam, Alprazolam) verwendet, die dann auf dem Schwarzmarkt angeboten werden. Im Jahr 2016 wurden mehr als eine halbe Million Tabletten sichergestellt, die neue Benzodiazepine oder ähnliche Stoffe enthielten – rund zwei Drittel mehr als noch 2015.
In einer zusammen mit dem Bericht veröffentlichten Analyse untersucht die EMCDDA den Benzodiazepinmissbrauch bei Hochrisiko-Opioidkonsumierenden in Europa. Obwohl die Verschreibung dieser Arzneimittelgruppe an Hochrisiko-Drogenkonsumierenden größtenteils legitime therapeutische Ziele verfolgt, kommt es durchaus vor, dass sie weitergegeben und missbraucht werden, was zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität in dieser Gruppe führt. Rund 40 Prozent aller Personen, die sich wegen des primären Konsums von Opioiden in Behandlung begaben, nannten Benzodiazepine als ihre sekundäre Problemdroge. Die Studie enthält auch eine Zeitleiste, an der sich die Meldung neuer Benzodiazepine an die EMCDDA ablesen lässt.
Anstieg der Todesfälle durch Überdosierung und die Rolle von Naloxon bei der Prävention
Der Bericht unterstreicht die Besorgnis über die hohe Zahl an Todesfällen durch Überdosierung in Europa, welche in den letzten vier Jahren stetig angestiegen ist. Laut Schätzungen starben in Europa (EU-28, Türkei und Norwegen) 2016 mehr als 9 000 Menschen an einer Überdosis, hauptsächlich in Verbindung mit Heroin und anderen Opioiden, die jedoch häufig in Kombination mit anderen Substanzen, insbesondere Alkohol und Benzodiazepinen, konsumiert wurden.
Die mit alten und neuen Opioiden verbundenen Probleme rücken erneut die Rolle des Opioid-Gegenmittels Naloxon bei Maßnahmen zur Verhinderung von Überdosierungen in den Fokus. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass es dringend notwendig ist, „die derzeitige Naloxonpolitik zu überprüfen und die Ausbildung und Sensibilisierung sowohl der Drogenkonsumierenden als auch der Fachleute, die mit der Droge in Berührung kommen könnten, zu verstärken“.
Die Vorsitzende des Verwaltungsrates der EMCDDA, Laura d’Arrigo, bemerkt abschließend: Die Gefahren, die von Drogen für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit in Europa ausgehen, machen nach wie vor eine gemeinsame Reaktion erforderlich. Der 2017 verabschiedete EU-Drogenaktionsplan bildet den Rahmen für die europäische Zusammenarbeit. Es ist äußerst wichtig, dass unser Überwachungssystem mit den sich verändernden Drogenproblemen und neu aufkommenden Entwicklungen Schritt hält.“
Pressestelle der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), 07.06.2018
 Das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) der Universität Hamburg führt ein Modellprojekt durch, das darauf abzielt, die Suizidprävention für Menschen mit Suchterkrankungen bundesweit effektiv und nachhaltig zu stärken. Fachkräften aus unterschiedlichen Settings des Suchthilfesystems kommt für die Suizidprävention bei Suchtkranken eine besondere Rolle zu. Sie sollen für die Thematik sensibilisiert, bedarfsgerecht und berufsgruppenübergreifend fortgebildet sowie langfristig miteinander vernetzt werden. Die Maßnahme wird als online-basiertes Social Learning konzipiert und setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:
Das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) der Universität Hamburg führt ein Modellprojekt durch, das darauf abzielt, die Suizidprävention für Menschen mit Suchterkrankungen bundesweit effektiv und nachhaltig zu stärken. Fachkräften aus unterschiedlichen Settings des Suchthilfesystems kommt für die Suizidprävention bei Suchtkranken eine besondere Rolle zu. Sie sollen für die Thematik sensibilisiert, bedarfsgerecht und berufsgruppenübergreifend fortgebildet sowie langfristig miteinander vernetzt werden. Die Maßnahme wird als online-basiertes Social Learning konzipiert und setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: