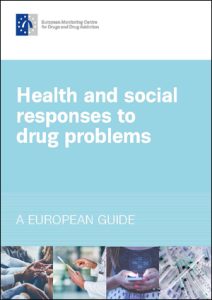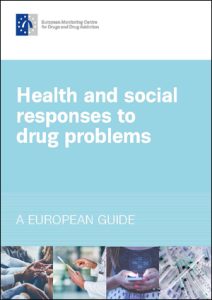 Wie kann den Problemen älterer Heroinkonsumierender begegnet werden? Wie können Todesfälle infolge des Konsums hochpotenter synthetischer Opioide (wie Fentanyl) vermieden werden? Wie können Schädigungen infolge des Drogen- und Alkoholmissbrauchs auf Festivals und in der Nachtclubszene verhindert werden? Mit solchen Fragen befasst sich der neue europäische Leitfaden der EU-Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA), der am 24.10.2017 unter dem Titel „Health and social responses to drug problems: a European guide“ (Gesundheits- und sozialpolitische Maßnahmen im Umgang mit Drogenproblemen: ein europäischer Leitfaden) veröffentlicht wurde. Gestützt auf Informationen aus 30 Ländern bietet die EMCDDA (in englischer Sprache) erstmals einen Überblick über die Maßnahmen und Interventionen, die zur Bekämpfung der Auswirkungen des illegalen Drogenkonsums aktuell zur Verfügung stehen.
Wie kann den Problemen älterer Heroinkonsumierender begegnet werden? Wie können Todesfälle infolge des Konsums hochpotenter synthetischer Opioide (wie Fentanyl) vermieden werden? Wie können Schädigungen infolge des Drogen- und Alkoholmissbrauchs auf Festivals und in der Nachtclubszene verhindert werden? Mit solchen Fragen befasst sich der neue europäische Leitfaden der EU-Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA), der am 24.10.2017 unter dem Titel „Health and social responses to drug problems: a European guide“ (Gesundheits- und sozialpolitische Maßnahmen im Umgang mit Drogenproblemen: ein europäischer Leitfaden) veröffentlicht wurde. Gestützt auf Informationen aus 30 Ländern bietet die EMCDDA (in englischer Sprache) erstmals einen Überblick über die Maßnahmen und Interventionen, die zur Bekämpfung der Auswirkungen des illegalen Drogenkonsums aktuell zur Verfügung stehen.
Der Leitfaden richtet sich sowohl an Personen, die sich auf der Ebene der gesundheitspolitischen Planung mit der Drogenproblematik befassen, als auch an Angehörige von Berufen mit direktem Kontakt zu Drogenkonsumenten. Er wird künftig alle drei Jahre neu aufgelegt (wobei die Online-Fassung regelmäßig aktualisiert wird) und ergänzt den jährlichen Europäischen Drogenbericht sowie den alle drei Jahre erscheinenden EU-Drogenmarktbericht.
Der Leitfaden beleuchtet die gesundheits- und sozialpolitischen Maßnahmen im Umgang mit Drogenproblemen aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Es geht um:
- Probleme im Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Drogen und Konsummustern;
- die Bedürfnisse verschiedener Gruppen (z. B. Frauen, junge Menschen, Migranten oder ältere Konsumenten);
- Probleme in verschiedenen Settings (z. B. Haftanstalten, Nachtclubs und Festivals, Schulen, Arbeitsplatz, lokale Gemeinschaften).
Als Nachschlagewerk für den Einstieg enthält er Zusammenfassungen und nutzerfreundliche Markierungen zum einfachen Auffinden von wesentlichen Informationen, Best-Practice-Beispielen und Anforderungen an Politik und Praxis. Außerdem erschließt er ein breites Angebot an Online-Informationen einschließlich Links zu empirischen Befunden und Tools.
Evidenzgestützte Maßnahmen
Im Leitfaden wird darauf hingewiesen, dass auf Evidenz gestützte Maßnahmen in Europa offenbar zunehmend an Bedeutung gewinnen und angesichts der derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen mehr denn je darauf geachtet wird, die knappen Ressourcen effizient einzusetzen. Der Leitfaden verweist auf das Best-Practice-Portal der EMCDDA, in dem zahlreiche Quellen enthalten sind, darunter das „Xchange“-Verzeichnis evidenzgestützter Programme sowie Standards zur Verbesserung der Maßnahmenqualität (Spotlight, S. 164).
Arbeit vor Ort
Drogenprobleme und gesundheitliche sowie soziale Probleme bestehen häufig gleichzeitig oder bedingen sich gegenseitig. Aus diesem Grund hebt der Leitfaden hervor, wie wichtig es für Betreuungseinrichtungen für Drogenkonsumierende ist, Beziehungen auch zu anderen Bereichen (wie sexuelle und psychische Gesundheitsvorsorge oder Wohnungsdienstleistungen) zu unterhalten, um ihre Wirksamkeit und Effizienz zu erhöhen (Spotlight, S. 31, S. 72). Einige Gruppen haben einen besonderen Bedarf an integrierten Dienstleistungen, beispielsweise ältere Opioidkonsumierende mit gesundheitlichen Problemen oder Konsumierenden mit psychischen Problemen. Der Leitfaden enthält Beispiele für eine Reihe von kooperativen Ansätzen in Europa.
Neue Technologien
Das Internet, Apps für soziale Netzwerke, neue Zahlungstechniken und Verschlüsselungssoftware verändern die Art und Weise, wie Drogen beschafft und vertrieben werden können. Diese neuen Gegebenheiten wirken sich nicht nur auf die Drogenmärkte und Konsummuster aus, sondern bieten auch neue Möglichkeiten für gesundheits- und sozialpolitische Maßnahmen in diesem Bereich. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf Initiativen im Bereich der elektronischen Gesundheitsdienste, die mithilfe digitaler Technologien Beratungsleistungen zur Schadensminimierung und Schulungen für Fachkräfte im Bereich der Drogenbehandlung anbieten und im Rahmen ihres Engagements gefährdete Jugendliche erreichen können, die zögern, sich an eine offizielle Drogenberatungsstelle zu wenden (Spotlight, S. 119).
Drogenbedingte Schädigungen vermindern
Der Leitfaden würdigt die bisher erzielten Fortschritte in Bezug auf die Prävention und Verminderung drogenbedingter Schädigungen (wie die Ausweitung der Angebote zur opioidgestützten Substitutionsbehandlung), weist jedoch gleichzeitig auch auf Bereiche hin, in denen noch weitere Möglichkeiten zur Verbesserung bestehen. Die Kosten für die Behandlung von Hepatitis-C-Infektionen machen einen erheblichen Teil der drogenbezogenen Gesundheitskosten in Europa aus (www.emcdda.europa.eu/publications/insights/hepatitis-c-among-drug-users-in-europe_en; www.emcdda.europa.eu/publications/pods/hepatitis-c-treatment_en). In dem Bericht werden die Vorteile einer besseren Koordination der Arbeit von Drogenstellen und speziellen Abteilungen für Lebererkrankungen hervorgehoben, um auf diese Weise ein angemessenes flächendeckendes Behandlungsangebot zu gewährleisten (Spotlight, S. 62).
Die Risikofaktoren in Verbindung mit einer tödlich verlaufenden Überdosierung sind mittlerweile hinreichend bekannt, und es wurden einige bemerkenswerte Fortschritte bei den lebensrettenden Interventionen erzielt wie beispielsweise die Verabreichung von Naloxon zur Therapie einer Überdosierung mit Opioiden. Die steigende Zahl der europaweit auftretenden Todesfälle infolge einer Überdosierung lässt jedoch darauf schließen, dass solche und weitere Maßnahmen zur Verringerung der Anzahl opioidbedingter Todesfälle weiter ausgebaut werden müssen.
Flexible Lösungen
Die Drogenproblematik in der heutigen Zeit kann sich schnell verändern und bestehende Strategien und Maßnahmenmodelle über den Haufen werfen. Neue Herausforderungen ergeben sich u. a. durch die rasche Verbreitung neuer psychoaktiver Substanzen wie beispielsweise hochpotente Opioide (z. B. Fentanyl; Spotlight, S. 52) und synthetische Cannabinoide (Spotlight, S. 81). Infolge der neuen Substanzen, die den Drogenmarkt überschwemmen, müssen auch die toxikologischen und forensischen Kapazitäten vor Ort ausgebaut werden.
Angesichts der soziodemografischen und wirtschaftlichen Veränderungen untersucht der Leitfaden die potenzielle Anfälligkeit von Menschen mit Migrationshintergrund und Asylsuchenden für Drogenprobleme und den Bedarf an Diensten, die die gesellschaftliche Vielfalt anerkennen und Vertrauen schaffen.
Die jüngsten Änderungen, die in Teilen Amerikas am Regulierungsrahmen für Cannabis vorgenommen wurden, werden in Europa von politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit mit Interesse verfolgt (Spotlight, S. 40). Darüber hinaus wächst in beiden Regionen das Interesse, das therapeutische Potenzial von auf Cannabis basierenden Arzneimitteln weiter zu untersuchen. Von Entwicklungen im Bereich der cannabisbezogenen Politik können Anstöße für Maßnahmen zur Prävention, Behandlung und Verminderung drogenbedingter Schädigungen ausgehen, und Innovationen außerhalb Europas können wertvolle Erkenntnisse liefern.
Die EU-Drogenstrategie (2013 bis 2020) zielt darauf ab, die Nachfrage nach und das Angebot von Drogen, Drogenabhängigkeit sowie drogenbedingte gesundheitliche und soziale Schäden zu verringern. Der Leitfaden unterstützt die Strategie im Bereich der Nachfragereduzierung und der Verringerung der gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des Drogenkonsums.
Alexis Goosdeel, Direktor der EMCDDA: „Wir glauben, dass die EMCDDA am besten zur Förderung der Gesundheit und der Sicherheit der europäischen Bürger beitragen kann, indem wir die herrschende Drogenproblematik analysieren und mögliche Maßnahmen sowie praktische Hilfsmittel zur Unterstützung politischer Entscheidungen und der praktischen Arbeit kritisch unter die Lupe nehmen. Dieser Leitfaden ist der erste und bisher ambitionierteste Versuch, Informationen zu den verfügbaren gesundheitsbezogenen und sozialpolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der Drogenproblematik in Europa in einer leicht zugänglichen Quelle zusammenzustellen. Indem er sowohl Wissenslücken und Schwächen in der Praxis als auch Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten hervorhebt, bildet dieser Leitfaden in diesem Bereich das Grundgerüst für ein erneuertes Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre.“
Pressestelle der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), 24.10.2017
 Im Verfahren des Landkreises Ravensburg gegen die AOK Baden-Württemberg zur Kostenübernahme einer Adaptionsbehandlung ist durch das Landessozialgericht Baden-Württemberg ein wichtiges Urteil ergangen (Az: L 11 KR 131/16).
Im Verfahren des Landkreises Ravensburg gegen die AOK Baden-Württemberg zur Kostenübernahme einer Adaptionsbehandlung ist durch das Landessozialgericht Baden-Württemberg ein wichtiges Urteil ergangen (Az: L 11 KR 131/16).