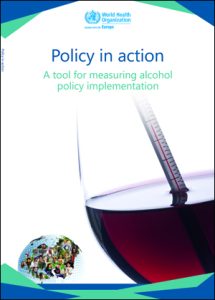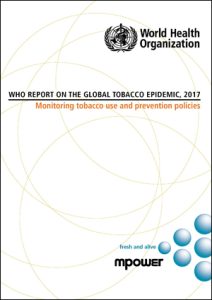Psychodynamische Therapien sind bei Menschen mit psychischen Erkrankungen nach dem aktuellen Stand der Forschung genauso wirksam wie andere „evidenzbasierte“ Verfahren wie beispielsweise die Kognitive Verhaltenstherapie. Dies geht aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt von Wissenschaftler/innen der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB), der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) sowie der Technischen Universität Dresden (TUD) hervor, dessen Ergebnisse am 1. Oktober in der renommierten Zeitschrift „American Journal of Psychiatry“ veröffentlicht wurden.
Psychodynamische Therapieverfahren zählen in der aktuellen Versorgungspraxis neben psychopharmakologischen und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungsansätzen weltweit zu den am weitesten verbreiteten Behandlungsangeboten für Menschen mit psychischen Erkrankungen. In Zusammenhang mit Forderungen nach mehr Wirksamkeitsnachweisen gerieten psychodynamische Therapien in der jüngeren Vergangenheit zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. In aktuellen Behandlungsleitlinien erscheinen sie häufig nur als Methode der zweiten Wahl, in manchen Ländern ist sogar ein weitgehender Ausschluss von der Regelversorgung zu verzeichnen.
Vor diesem Hintergrund gingen Christiane Steinert (JLU), Thomas Munder (PHB), Sven Rabung (AAU), Jürgen Hoyer (TUD) und Falk Leichsenring (JLU) der Frage nach, wie wirksam psychodynamische Therapien im Vergleich zu „evidenzbasierten“ Verfahren sind. In einer Meta-Analyse fassten die Autor/innen 23 hochwertige randomisiert-kontrollierte Studien zusammen, in denen insgesamt 2.751 Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen untersucht wurden. 21 Studien verglichen psychodynamische Therapie mit kognitiver Verhaltenstherapie, zwei Studien mit Pharmakotherapie. Die behandelten Störungsbilder umfassen depressive Erkrankungen (acht Studien), Angststörungen (vier Studien), Posttraumatische Belastungsstörungen (eine Studie), Essstörungen (vier Studien), Substanzbezogene Störungen (zwei Studien) und Persönlichkeitsstörungen (vier Studien).
Anders als in herkömmlichen Meta-Analysen wurden die in diesen Studien miteinander verglichenen Behandlungen nicht auf Unterschiedlichkeit, sondern erstmalig explizit hinsichtlich ihrer Gleichwertigkeit bewertet, was strengere methodische Maßstäbe erfordert. Zusätzlich berücksichtigten die Wissenschaftler/innen die Qualität der einbezogenen Studien sowie mögliche Interessenskonflikte innerhalb der Studien aber auch innerhalb des eigenen Forschungsteams. Sven Rabung zum Ergebnis der Studie: „Die zusammenfassende Auswertung der vorliegenden Studien belegt, dass die psychodynamischen Therapien grundsätzlich als genauso wirksam wie die evidenzbasierten Vergleichsbehandlungen, und speziell auch die kognitive Verhaltenstherapie, gelten können.“
Rabung führt weiter aus: „Die vorliegende Meta-Analyse belegt somit eindrücklich das Potential psychodynamischer Therapien als gleichwertige Behandlungsoption im Reigen der verfügbaren evidenzbasierten Behandlungsalternativen. Dies ist von großer Versorgungsrelevanz, da jedes Therapieverfahren nur bei einem Teil der Patient/innen zum gewünschten Erfolg führt und deswegen potente Behandlungsalternativen benötigt werden.“
Publikation:
Steinert C, Munder T, Rabung S, Hoyer J, Leichsenring F: Psychodynamic Therapy: As Efficacious as Other Empiracally Supported Treatments? A Meta-Analysis Testing Equivalence of Outcomes. Am J Psychiatry 2017; 174:943–953; doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17010057
Begleitendes Editorial: Milrod B: The Evolution of Meta-Analysis in Psychotherapy Research. Am J Psychiatry 2017; 174:913–914; doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17050539
Pressestelle der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 06.10.2017