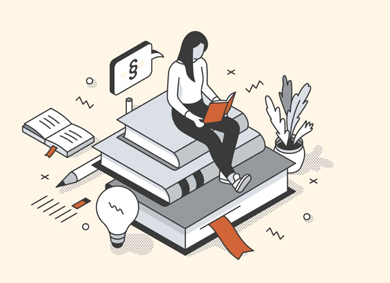„Die Sucht- und Drogenpolitik in Deutschland steht aktuell vor großen Herausforderungen. Sorge bereiten uns die Ausbreitung von Crack, einer rauchbaren Form von Kokain, sowie synthetischen Opioiden wie Fentanyl, ein Wirkstoff, der lebensbedrohlicher ist als Heroin. Mit den Folgen von Alkohol, Tabak und Co. erwarten uns gewaltige Probleme im Gesundheitssystem und in der Gesellschaft. Um die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells zu sichern, brauchen wir eine Sucht- und Drogenpolitik, die den Stand der Forschung anerkennt und konstruktiv nach vorne blickt“, sagt Dr. Peter Raiser, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Mit Blick auf die Bundestagswahlen und die anschließenden Koalitionsverhandlungen hat sich die DHS jetzt mit suchtpolitischen Forderungen an die Politik gewandt. Auch die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat das entsprechende DHS Positionspapier mitgezeichnet.
„Die Sucht- und Drogenpolitik in Deutschland steht aktuell vor großen Herausforderungen. Sorge bereiten uns die Ausbreitung von Crack, einer rauchbaren Form von Kokain, sowie synthetischen Opioiden wie Fentanyl, ein Wirkstoff, der lebensbedrohlicher ist als Heroin. Mit den Folgen von Alkohol, Tabak und Co. erwarten uns gewaltige Probleme im Gesundheitssystem und in der Gesellschaft. Um die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells zu sichern, brauchen wir eine Sucht- und Drogenpolitik, die den Stand der Forschung anerkennt und konstruktiv nach vorne blickt“, sagt Dr. Peter Raiser, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Mit Blick auf die Bundestagswahlen und die anschließenden Koalitionsverhandlungen hat sich die DHS jetzt mit suchtpolitischen Forderungen an die Politik gewandt. Auch die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat das entsprechende DHS Positionspapier mitgezeichnet.
Die Lage ist ernst: Jeder zehnte Deutsche hat ein Suchtproblem. Noch weitaus mehr Menschen konsumieren Alkohol, Tabak und andere Suchtmittel in gesundheitsschädlicher Weise, auch wenn keine Abhängigkeit vorliegt. Ein großer Teil der Bevölkerung ist als Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde, Kollegen oder Nachbarn von Suchtfragen mitbetroffen. Sucht und der Konsum von Rauschmitteln belasten die Volkswirtschaft mit rund 150 Milliarden Euro jährlich, allein für Alkohol und Tabak. Die Folgekosten von anderen Süchten wie beispielsweise Medikamentenabhängigkeit oder Verhaltenssüchten wie Glücksspiel kommen hinzu.
„Das enorme Ausmaß der Herausforderungen zeigt sich beispielsweise auch in den Zahlen der Drogentoten, die zuletzt auf einem Höchststand lagen, und in der Kokainschwemme. Die Anzahl der Handelsdelikte mit Kokain steigt in Deutschland seit Jahren an. Durch die Verbreitung des Konsums von Crack sehen wir dramatische Folgen in den örtlichen Drogenszenen. Die Belastungen in den Kommunen und in der Gesellschaft werden weiter ansteigen, wenn die Politik nicht gegensteuert“, erläutert DHS Geschäftsführer Dr. Peter Raiser.
Parallel dazu sieht sich die Suchthilfe mit teils existenzbedrohenden Mittelkürzungen und Mittelstreichungen konfrontiert. „Wir brauchen dringend mehr statt weniger zeitgemäße und niedrigschwellige Hilfen und Suchtberatung, um der bekannten Unterversorgung von Suchtkranken entgegenzuwirken“, betont Christina Rummel, ebenfalls DHS Geschäftsführerin. Drei Viertel der Suchtberatungsstellen verfügen nicht über genügend Mittel, um ihre Aufgaben kostendeckend zu erfüllen. Leistungen werden zurückgefahren und Einrichtungen schließen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine im September 2024 veröffentlichte DHS-Analyse zur Finanzierung der Suchtberatungsstellen.
„Die DHS fordert von der künftigen Bundesregierung, die Suchtberatung zu sichern und weitere öffentliche und niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Hier muss der Bund tätig werden. Die bislang nicht gesetzlich verankerte Leistung der Suchtberatung muss verlässlich abgesichert werden“, so DHS Geschäftsführerin Christina Rummel.
Das DHS Positionspapier: „Suchtpolitische Forderungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen an eine Regierungskoalition der Bundesrepublik Deutschland 2025-2029“ steht auf der Website der DHS zur Verfügung: https://www.dhs.de/unsere-arbeit/stellungnahmen
Pressestelle der DHS, 29.1.2025