Schlagwort: Medizinische Rehabilitation
-

Conrad Tönsing, Claudia Westermann
Fachklinik Hase-Ems
Medizinische Rehabilitation – individuell, passgenau und aktuell
Weiterlesen: Fachklinik Hase-Ems -
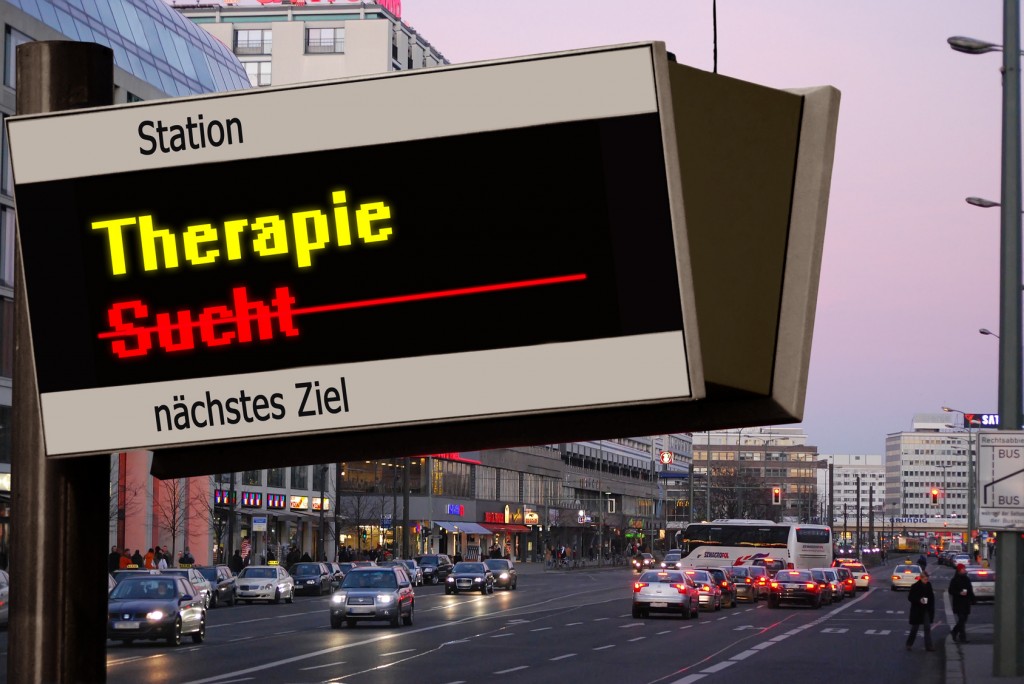
Iris Otto, Prof. Dr. Andreas Koch
Belegungsumfrage des buss
Reha-Einrichtungen zunehmend unter Druck
Weiterlesen: Belegungsumfrage des buss -

Dr. Jens Hinrichs, Dr. Anne-Kathrin Exner, Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann
Der Science Circle
Ideenwerkstatt des Nordrhein-Westfälischen Forschungsverbundes Rehabilitationswissenschaften
Weiterlesen: Der Science Circle -

Iris Otto, Prof. Dr. Andreas Koch
Verbandsauswertung des buss
Überblick zu den Basisdaten 2014 und den Katamnesedaten 2013
Weiterlesen: Verbandsauswertung des buss -

Dr. Andreas Koch, Denis Schinner
BORA kompakt
Was Sie über die BORA-Empfehlungen wissen sollten
Weiterlesen: BORA kompakt



