Schlagwort: Statistik
-

Dr. Hans Wolfgang Linster, Prof. Dr. Andreas Koch
Differenzierte Ergebnismessung zu Konsumverhalten und Teilhabe
Katamneseerhebung mit dem KDS 3.0
Weiterlesen: Differenzierte Ergebnismessung zu Konsumverhalten und Teilhabe -

Karl Lesehr, Prof. Dr. Andreas Koch
Den Datenschatz kompetent befragen
Nutzungsmöglichkeiten des KDS 3.0
Weiterlesen: Den Datenschatz kompetent befragen -
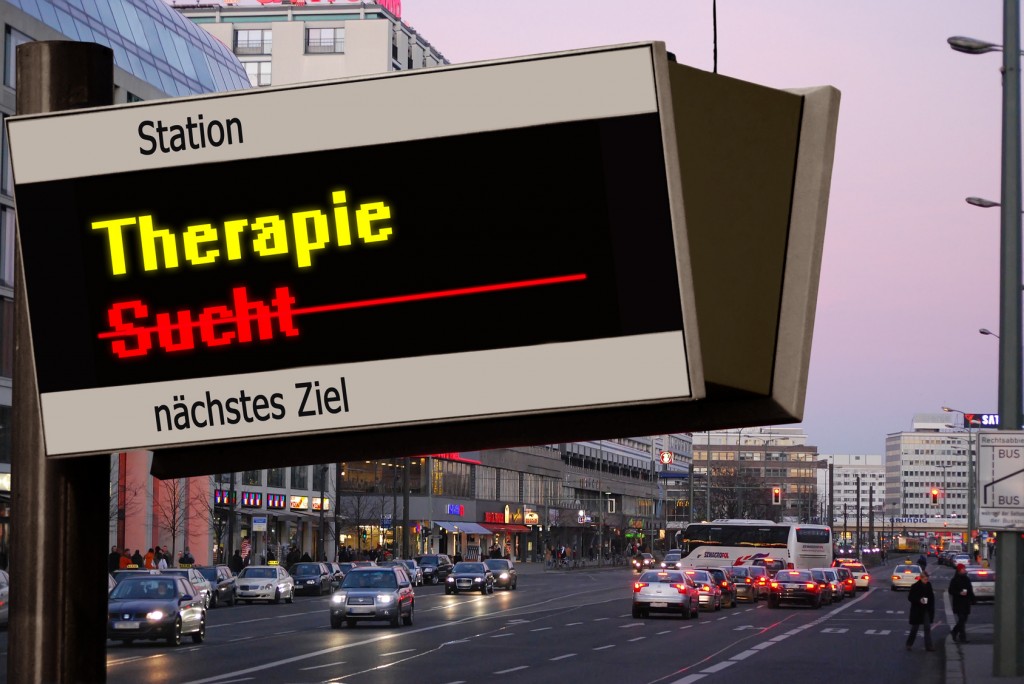
Iris Otto, Prof. Dr. Andreas Koch
Belegungsumfrage des buss
Reha-Einrichtungen zunehmend unter Druck
Weiterlesen: Belegungsumfrage des buss -

Iris Otto, Prof. Dr. Andreas Koch
Verbandsauswertung des buss
Überblick zu den Basisdaten 2014 und den Katamnesedaten 2013
Weiterlesen: Verbandsauswertung des buss -

Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel
Verbreitung des Cannabiskonsums
Weiterlesen: Verbreitung des Cannabiskonsums





