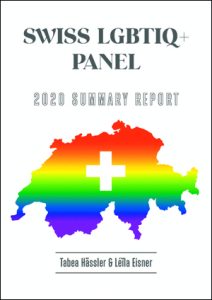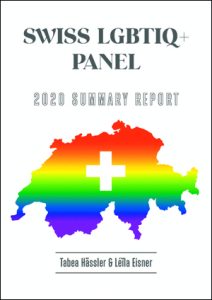 Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten erfahren in der Schweiz nach wie vor strukturelle Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und körperliche Gewalt. Dies zeigen Sozialpsychologinnen der Universitäten Zürich und Lausanne in einer Befragung von 1.400 LGBTIQ*-Menschen. So ist ihnen etwa die Ehe im Moment noch verwehrt, obwohl sich dies mehr als die Hälfte von ihnen wünschen würde. Besonders ausgeprägt sind die Ungleichheiten bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten.
Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten erfahren in der Schweiz nach wie vor strukturelle Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und körperliche Gewalt. Dies zeigen Sozialpsychologinnen der Universitäten Zürich und Lausanne in einer Befragung von 1.400 LGBTIQ*-Menschen. So ist ihnen etwa die Ehe im Moment noch verwehrt, obwohl sich dies mehr als die Hälfte von ihnen wünschen würde. Besonders ausgeprägt sind die Ungleichheiten bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten.
2020 war ein entscheidendes Jahr für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ*) Personen in der Schweiz: Die Bevölkerung stimmte für die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes, Stände- und Nationalrat sprachen sich für die Ehe für alle aus. Einblicke in die Situation von LGBTIQ*-Personen während dieser Zeit ermöglicht die diesjährige Befragung des Schweizer LGBTIQ*-Panels. Für die Studie unter der Leitung der Sozialpsychologinnen Tabea Hässler (Universität Zürich, UZH) und Léila Eisner (Universität Lausanne) wurden 2020 über 1.400 LGBTIQ*-Personen zu aktuellen politischen Debatten, bestehender Diskriminierung, Unterstützung und die Rolle der Schule befragt.
Verbreiteter Wunsch nach Ehe und Kindern
Während etwa die Ehe bei heterosexuellen Personen immer weniger beliebt ist, würde eine Mehrheit (55 Prozent) der lesbischen, schwulen oder bisexuellen Personen gerne heiraten, wenn dies in der Schweiz legal wäre. Damit einher geht oft der Wunsch nach Kindern: Über ein Drittel der Angehörigen sexueller Minderheiten möchte gerne Kinder haben. Bei den Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten, also trans, non-binäre oder intergeschlechtliche Personen, äußert über ein Fünftel diesen Wunsch.
Engagement und Sorge rund um das Antidiskriminierungsgesetz
Viele LGBTIQ*-Personen haben sich 2020 aktiv für die Kampagne zur Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes eingesetzt. Sie haben beispielsweise Gespräche mit heterosexuellen Personen geführt (80 Prozent), Beiträge in sozialen Netzwerken verfasst (57 Prozent) und Regenbogenfahnen aufgehängt (48 Prozent). „Während das Ergebnis der Abstimmung – die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes um die sexuelle Orientierung – begrüßt wurde, zeigten sich Befragte enttäuscht über abwertende Kommentare und teilweise offene Hassreden vor der Abstimmung“, sagt UZH-Postdoktorandin Tabea Hässler. „Einige Teilnehmende waren zudem betrübt darüber, dass die Geschlechtsidentität nicht ebenfalls berücksichtigt wurde.“
Ausgrenzung auf körperlicher, struktureller und sozialer Ebene
Als alarmierend stufen die Studienautorinnen die Diskriminierungsraten ein, die aus ihrer Befragung hervorgingen: So wurden im vergangenen Jahr 40 Prozent der Studienteilnehmenden von Männern sexuell belästigt. Angehörige geschlechtlicher Minderheiten waren insgesamt doppelt so häufig Opfer von Diskriminierung wie Angehörige sexueller Minderheiten, wobei sich die Diskriminierung auf körperliche Gewalt (16 Prozent vs. 8 Prozent), soziale Ausgrenzung (55 Prozent vs. 33 Prozent) und strukturelle Benachteiligung (78 Prozent vs. 40 Prozent) beziehen konnte. Letztere schließt zum Beispiel fehlende Rechte wie das Recht auf Ehe und Adoption, die fehlende Möglichkeit, sich in offiziellen Dokumenten als „divers“ oder „intergeschlechtlich“ einzutragen, oder auch fehlende Unisex-Toiletten mit ein. Eine Erklärung für die großen Unterschiede könnte gemäß den Studienautorinnen darin liegen, dass Angehörige geschlechtlicher Minderheiten kaum öffentlich sichtbar sind und geschlechtliche Vielfalt insgesamt gesellschaftlich wenig thematisiert wird.
Mangelnde Sensibilisierung in der Schule
Diese Tendenz zeigt sich unter anderem in den Schulen: Bei den Studienteilnehmer*innen unter 21 Jahren gab die Hälfte der Befragten an, dass die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität in der Schule überhaupt nicht zur Sprache kam. „Dies steht in starkem Kontrast zu den Bedürfnissen schulpflichtiger LGBTIQ*-Personen“, wie Léïla Eisner von der Universität Lausanne festhält. Denn obwohl diese besonders gefährdet sind, Opfer von Mobbing und Diskriminierung zu werden, wissen sie oft nicht, an wen sie sich wenden können. „Eine stärkere Sichtbarkeit und Unterstützung durch Lehrer*innen und Mitschüler*innen wäre hier eine große Hilfe“, so Eisner.
Längsschnittstudie zeigt Veränderungen über die Zeit
Aus der aktuellen Befragung geht hervor, dass Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten in der Schweiz nach wie vor Diskriminierung erfahren und sich gesellschaftlich nicht vollständig akzeptiert fühlen. Wie die Studienautorinnen unterstreichen, ist die Tendenz bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten besonders ausgeprägt, was sie innerhalb der LGBTIQ+ Community zu einer gefährdeten Gruppe macht.
Um die Entwicklung weiterzuverfolgen und nachzuvollziehen, wie Veränderungen im sozialen und politischen Kontext die Situation von LGBTIQ*-Personen beeinflussen, wird das LGBTIQ*-Panel fortgesetzt: Neben Fragen zu Diskriminierung, Problemen, aber auch zu erfahrener Unterstützung kommen dabei auch aktuelle Themen zur Sprache. Die nächste Befragung findet bereits im Januar 2021 statt.
Originalpublikation:
Hässler, T., & Eisner, L. (2020). Swiss LGBTIQ+ Panel – 2020 Summary Report. https://doi.org/10.31234/osf.io/kdrh4
Pressestelle der Universität Zürich, 14.12.2020
 Im Jahr 2017 fasste der Landtag von Sachsen-Anhalt den Beschluss, dass die Landesstelle für Suchtfragen gebeten sei, ein Konzept zum Nichtraucherschutz und zur Prävention zu entwickeln (Beschluss des Landtags 7/1239). Dieses Konzept wurde im Dezember 2020 durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration dem Landtag vorgelegt.
Im Jahr 2017 fasste der Landtag von Sachsen-Anhalt den Beschluss, dass die Landesstelle für Suchtfragen gebeten sei, ein Konzept zum Nichtraucherschutz und zur Prävention zu entwickeln (Beschluss des Landtags 7/1239). Dieses Konzept wurde im Dezember 2020 durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration dem Landtag vorgelegt.